Home > Stefan Zweig > THE 26 STEFAN ZWEIG TEXTS ON THIS SITE > "In the Snow" (1901) and other stories by Stefan Zweig
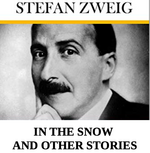 "In the Snow" (1901) and other stories by Stefan Zweig
"In the Snow" (1901) and other stories by Stefan Zweig
Tuesday 16 April 2019, by
Three dramatic short stories by the author of Letter From an Unknown Woman :
1. In the Snow (1901) – Word comes to a Jewish community celebrating Hanukah in a small town in medieval Germany that a large group of religious fanatics are on their way with hate in their hearts and blood on their hands (4,400 words);
2. The Cross (1906) – A French officer is cut off behind enemy lines after an ambush during the Napoleonic War in Spain and desperately tries to survive amid the immeasurable hostility of the population (3,800 words);
3. The Wedding in Lyon (1927) – A group of condemned prisoners is awaiting execution in a makeshift prison in Lyon during the French Revolution when a new group of prisoners is brought in, and a young couple is miraculously reunited (3,600 words).
These stories have all been translated from the original German specially for this site [1].
An e-book, with the original texts in an annex, is available for downloading below.
The original German-language versions can be seen here.
1. IN THE SNOW
A little German town in the Middle Ages not far from the border with Poland, with the stocky sedateness so characteristic of the buildings of the 14th century. The colourful animation that usually prevails on its streets has given way to a sheen of white that stretches across the broad city walls and on the peaks of the towers that the night has already enveloped in a veil of mist.
Night is rapidly falling. The loud, confused agitation of the streets, the activity of many busy people has diminished to a steady trickle of sound that seems to be echoing from far away, only pierced by the monotonous song of the evening church-bells at regular intervals. The end of the working day has come at last for the tired, sleepy hand-workers, the lights are becoming ever more sparse and isolated, and finally go out altogether. The city is stretched out like a powerful animal, deep asleep.
All sounds have died out and even the quavering voice of the prairie wind has diminished to a soft lullaby; one can just hear the light lisping of the falling snowflakes as their meandering comes to an end . . .
Suddenly a vague sound can be heard coming from afar, like the distant beating of hoofbeats that are coming closer. The surprised watchman in the tower, overwhelmed with sleep, goes to the window to look out. And there he sees a rider in full gallop heading towards the gate, who a minute later asks for permission to enter in a raw voice harshened by the cold. The gate is opened and the man goes through, leading at his side a steaming horse that he confides to the gate-keeper, overcoming his reserves with a few words and a considerable sum of money; he then hurries off, in rapid strides that reveal his knowledge of the village geography, across the deserted market-place shimmering in its whiteness, through silent side-streets and snowed-over passageways, over to the far end of the little town.
There a few of small houses are pressed together as if mutually needing the support of one another. They are all without decoration, austere, blackened by smoke and somewhat askew, and they are all utterly devoid of animation hidden away as they are in these back streets. They give the impression that they have never known a happy celebration full of gayness and festivity; these closed and blackened windows seem as if they had never been opened to let in cheer and joyfulness, as if no bright ray of sunshine had ever shone playfully through their window-panes. Solitary, like frightened children afraid of others, they press themselves together in the narrow complex of the Jewish ghetto.
The stranger stops before one of these houses, the biggest and relatively most imposing. It belongs to the richest man of the small community, and also serves as its synagogue.
A glimmer of light penetrates between the folds of the closed curtains, and from the illuminated room voices singing a hymn ring out. The celebration of Hanukah has just peacefully begun, the celebration of jubilation at the great victory of the Maccabees, a day when the exiled nation oppressed by fate remembers its might of yesteryear, one of the few joyful days that law and life have granted them. But the chants are impregnated with melancholy and longing, and the metallic tones of the voices are rendered harsher by the thousands of tears that have been shed; the song rings out over the isolated little street like a hopeless complaint and fades away . . .
The stranger waits a moment immobile in front of the house, lost in thoughts and dreams, and heavy, swollen tears mix with sobs in his throat as he instinctively sings with them the ancient, sacred melodies that flow from his heart. His soul is filled with deep devotion.
Then he gathers himself together. With hesitating steps he goes up to the closed door and the knocker pounds powerfully on the door that trembles with the muffled sound.
And the trembling vibrates throughout the entire building . . .
Immediately the singing above stops as if at a given, prearranged signal. They have all become pale and are looking anxiously at one another. At once the festive atmosphere has disappeared, the dream of the victorious power of Judah Maccabee, who in spirit had been standing encouragingly at their sides, has been dissipated, the brilliant kingdom of the Jewish people that had been glowing before their eyes has vanished, they are again poor, trembling, helpless Jews. Reality is staring them again in the face.
Frightful stillness. The prayer-book has fallen from the trembling hand of the prayer leader, no one fully masters their trembling lips. A horrible anguish has arisen in the room and has seized all their throats in its iron grasp.
They all well know why.
A terrible word had come to them, a new, unheard-of word whose bloody significance had been imposed upon them and their people. The Flagellants had appeared in Germany, wild religious fanatics who in the passion and agitation of their ecstasy flagellated their own bodies; drunken crazed hordes who had slaughtered and martyred thousands of Jews whom they wanted to forcefully tear away from their most sacred protection, the ancient belief of their fathers. And that was their worst fear, for they had all survived with a blind, fatalistic patience being attacked, beaten, robbed and subjugated; they had all lived through attacks in the middle of the night with burning and looting, and a shudder always ran through their bodies when they thought of such times.
And a few days beforehand the first rumours had been heard that a horde of them had burst into their region where the Flagellants had previously only been known by name, and that they were no doubt not far off any longer. Perhaps they were already here?
A terrible fear clutched at all of their hearts. They could see the bloodthirsty hordes once again wildly storming into their houses with their drunken, wine-sodden faces and with burning torches in their hands, already rang in their ears the heart-rendering cries for help of their women who were falling victim to the savage lust of the murderers, they could already feel the lightening blows of their weapons. It was like a nightmare, clear and realistic.
The stranger looked up and listened, and as no one opened the door he knocked again, knocks that again rang dully and menacingly throughout the silent, disturbed house.
Meanwhile the owner of the house, the prayer leader, whose undulating white beard and advanced age gave him the appearance of a patriarch, was the first to have somewhat mastered his feelings. In a low voice he murmurs: “As God wills.” And then he leans over to his granddaughter, a lovely girl who in her anguish resembles a doe turning her large, pleading eyes towards her pursuer: “See who it is out there, Lea!”
The young woman, upon whose face all eyes are concentrated, goes to the window with timid steps, where she draws the curtains apart with trembling, pale fingers. And then a cry comes from the bottom of her soul: “Praise God, just one man.”
“God be praised” rings out anew from all sides, like a sigh of relief. And now there is also activity among all those immobile forms on whom the terrible nightmare had weighed; several groups have taken form, some are standing in silent prayer, others are discussing with anguish and uncertainty the unexpected arrival of the stranger, who is now being shown through the door.
The whole room is filled with the heavy, oppressive odour of logs, and with the presence of so many people, all gathered around the richly-laden festive table on which the symbol of the holy evening, the seven-branched candelabrum, is standing, with each of its candles burning languidly in the somewhat smoky atmosphere. The women are wearing sumptuous gowns decorated with jewels, the men are wearing flowing garments with white prayer-shawls. And the narrow room is swept by a deep sense of solemnity, as it can only be on occasions of deep devotion.
The quick steps of the stranger are coming up the stairs, and then he comes into the room.
At the same time a sharp, biting gust of wind sweeps into the warm room through the open door. And icy coldness streams in with the snow-filled wind and chills them all. The gust of wind extinguishes the flickering candles in the candelabrum, except for one that still flicks back and forth in its death throes. Right away the room is enveloped a heavy, unpleasant gloom, as if suddenly the cold night had passed right through the walls. All at once the comfortable, peaceful atmosphere has disappeared, everyone feels the dreadful premonition that is implicated by the extinguishing of the sacred candles, and the superstition makes them cringe anew. But no one dares say a word.
At the door a tall, black-bearded man hardly more than thirty years old is standing, who quickly takes off the coat and cap with which he had protected himself from the cold. And in an instant, as his face becomes visible in the little flickering light of the last candle-flame, Lea rushes over and embraces him.
It is Joshua, her fiancé from the neighbouring town.
The others also gather excitedly around and greet him warmly, only to soon fall silent as he turns towards his bride with a serious, sad expression on his face; terrible, tragic events have worn deep furrows on his brow. All are looking anxiously at him, and he cannot prevent his words gushing out to express the onrushing flood of his feelings. He grasps the hands of those around him and the heavy secret softly escapes from his lips:
“The Flagellants are here!”
The eyes that had been looking at him questioningly have frozen, and he can feel how the pulses of the hands that he is holding have suddenly almost stopped. With trembling hands the prayer leader supports himself on the heavy table, so that the crystal of the glasses begins to sing out softly, swaying with trembling tones. Anguish again takes hold of the oppressed hearts and drives the last drops of blood from the shocked, desolate faces that are staring fixedly at the floor.
The last candle flickers once more and goes out . . .
Only the suspended lamp still casts light on the haggard, devastated people whom the word had struck like a lightening bolt.
A voice softly murmurs the resigned words of those used to the blows of fate: “God has willed it!”
But the others still stand there indecisively.
And the newcomer continues speaking, in a reluctant, torn voice as if he didn’t want to hear his own words.
“They are coming – many – hundreds – and many other people with them. They have blood on their hands – they have murdered, thousands – all of us, in the east. They have already been in my town . . . .”
He is interrupted by the frightful shriek of a woman, whose flood of tears cannot lessen the violence of her cry. A young wife only recently married throws herself down before him.
“They are there? And my parents, my brothers and sisters? Has something happened to them?”
He leans down to her and his voice sobs as he softly says to her, as if in consolation: “They no longer know suffering on this earth.”
And again everything has become still, deadly still . . . The frightful phantom of the fear of death is in them and makes them all tremble . . . Not one of them did not have a loved one in that other town.
And then the prayer leader, tears running down his silver-grey beard, begins to brokenly sing the ancient, solemn prayer for the dead, in a brittle voice that he can scarcely master. All join in. They are not even aware that they are singing, they know neither the words nor the melody that they mechanically follow, each is only thinking of his or her loved ones. And the song becomes ever more powerful, the breathing ever deeper, the suppression of the feelings that are flooding out becomes ever more difficult, ever more confused become the words, and finally they are all sobbing together in a wild, disheveled outbreak of sorrow. An infinite pain that no words can express has fraternally overtaken them all.
Deep silence . . .
Only from time to time a deep sob that cannot be suppressed . . .
And then again the heavy, numb voice of the speaker:
“They all called out to God. None survived. I was the only one who escaped thanks to the guidance of God . . .”
“His name be praised”, murmurs the whole group in an instinctive upsurge of devotion. The words from the mouths of the broken, trembling people sound like a well-worn formula.
“I came back late to the town from a journey; the Jewish ghetto was already full of plunderers . . . I wasn’t recognized, so I could have fled – but I was pushed on instinctively to where I belong, to my people, to be among those who were falling before the hammering blows of the fists. Suddenly one of them rode upon me, swinging at me – he missed and swayed in his saddle. And then suddenly the urge to live took hold of me, that mysterious chain that is joining us together here in our lamentation – an impulse gave me strength and courage, I wrenched him from his mount and rushed away myself on his horse onto the plains, into the dark night, to come to you here: I have been riding for a day and a night.”
He pauses for an instant. Then he says with a solid voice: “Enough of all that! First of all, what is to be done?”
And from all sides comes the answer:
“Flight!” – “We must flee!” – “Over to Poland!”
That is the only means of salvation that they know, the usual, shameful and yet irreplaceable means of struggle of the weak against the strong. No one thinks of resistance. A Jew should fight to defend himself? That is laughable and unthinkable in their eyes, they are no longer living in the time of the Maccabees; it is again the time of serfdom, of those who came out of Egypt, of the nation with the eternal stamp of weakness and servitude that after centuries of flight the years cannot wash away.
Therefore flight!
One of them timidly made the suggestion that they could ask the citizens of the town for protection, but a contemptuous smile was the answer. The destiny of the oppressed nation had always been in their own hands and in the hands of their God. They could no longer trust anyone else.
They are all now discussing the details of what is to be done. All of these men, whose only aim in life had been to amass money, who had considered wealth as the summit of human happiness and achievement, now agree that no sacrifice would be too great if it could hasten their flight. All of their belongings had to be converted into ready money, even under the most unfavourable conditions; wagons had to be procured, with teams of horses and means of protection from the cold. In one stroke the fear of death has done away with the ingrained characteristics of their people, just as their individual personalities are merged together into a common will. In all the pale, discouraged faces thoughts are directed towards one single objective.
And when the morning shot its blazing torches into the sky everything had already been discussed and decided. With the mobility of a nation that has wandered throughout the world, they had adapted themselves to their harsh destiny of exile, and their final decisions and dispositions rang out again in prayer.
Each went out to accomplish their part of the common task.
And under the steady song of the snowflakes that had already built high walls in the glimmering streets many sighs died down . . .
The mobile door of the great town gate had fallen ominously down behind the last wagon of the refugees . . .
The moon only shone weakly in the sky above, but her beams silvered the myriads of snowflakes dancing extravagant figures that accumulated on their clothes, that flitted about the snorting nostrils of the horses and that crunched under the wheels making their way with difficulty through the thick masses of snow.
From inside the wagon came whispering in low voices. Women exchanged melancholy, lightly singing words recalling memories of their home town that still lay there in its secure mass, conscious of its force, close before their eyes; clear children’s voices asking questions and wondering about a thousand things gradually became quieter and rarer and finally merged into a steady breathing, set off from the sonorous tones of the men, who were worriedly discussing their future prospects and murmuring prayers in low voices. All were huddled closely together in the consciousness of their sense of community and from instinctive fear of the cold that was blowing in icily from the little holes and openings and that was freezing the fingers of the drivers.
The lead wagon stopped.
Immediately all the other wagons in the column also come to a halt. From all of the mobile tents pale faces poked out to learn why. The patriarch descended from the leading wagon and everyone followed his example, for they all had understood the reason for the stop.
They were not yet far from the town; through the white drizzle one could still dimly see its tower that rose like a menacing hand over the broad plain, and from whose peak there was a bright glow like that of a precious stone on a ring.
Here everything was flat and white, like the frozen surface of a lake. Scattered about could be seen little fenced mounds of equal heights, under which they knew were their loved ones who, exiled and solitary like their whole nation far from its original homeland, had found here a quiet, eternal resting-place.
Deep silence, only broken by light sobbing.
And hot tears run down the frozen, long-suffering faces and become drops of ice upon the snow.
All fear of death is gone and forgotten as they looked at the deep, silent tombstones. And they are all overcome at the same time with an endless, tearful, wild longing for this eternal, quiet calm in “the good place”, together with their loved ones. So much of their childhood was sleeping under the white covering, so many sacred memories, so much infinite happiness that they would never again be able to experience. One and all were filled with longing for “the good place”.
But time is pressing them on.
They creep back into the wagons pressed tightly close to other, for while they hadn’t felt the biting cold when they were outside, now the icy frost again creeps over their shivering, quaking bodies and sets their teeth chattering. In the gloom of the wagons they look at one another with expressions of ineffable anguish and endless suffering . . .
Their thoughts constantly turn to the way they had come, for the wide traces of the wagons in the snow lead back to the place of their longing, to “the good place”.
It is past midnight. The wagons are already far from the town, in the middle of the immense plain brightly illuminated by the moon, whose glimmering reflections on the falling snow make it seem like white walls of curtains. The powerful horses tiredly stamp through the deep drifts that slowly rise up all around them; slowly, almost unnoticeably, the vehicles advance ever more hesitatingly, at every instant they seem to be on the verge of standing still.
The cold has become frightful and cuts like steel knives into their bodies that have already lost much of their mobility. Little by little the wind is growing stronger, singing wildly and rattling throughout the wagons. The tent coverings are constantly shaken and almost ripped away as if by giant hands that were tearing at them, and only with the greatest effort can they be more solidly fastened by the frozen hands.
And the storm rages ever stronger and under its song can be heard the praying, lightly whispering voices of the men, whose icy lips can only form words with the greatest effort. The whistling of the wind drowns out the stunned, frightened sobbing of the women and the headstrong whining of the children whose lethargy had been overcome by the strength of the cold.
The wheels roll on, groaning, through the snow.
In the last wagon Lea is nestled in the arms of her fiancé, who is recounting the great disaster in a sad, monotonous voice. And he wraps his strong arms around her small, maidenly body as if he wanted to protect her from the aggression of the cold and the pain. She looks at him with thankful eyes, and in the whirl of complaints and storm-sounds a few tender, melancholy words are exchanged that help both of them forget thoughts of danger and death . . .
Suddenly everyone in shaken by a hard jolt.
And then the wagon stops still.
Through the raging flood of the storm shouts, the sound of whips and the murmur of excited voices that will not be calmed can be heard coming confusedly from the leading wagons. People leave the wagons, hurry forwards through the biting cold to where one of the team of horses has fallen down and brought the other down with it. Men have gathered around the animals wanting to help but there is nothing to be done, for the wind is blowing at them as if they were weak, carefree dolls, the snowflakes are blinding their eyes, their hands are frozen and powerless, for their fingers are lying one against the other like inert strips of wood. And all around there is no possibility of help, just the plain that in proud consciousness of its endlessness fades away without horizons into the snowy twilight, and the storm that indifferently engulfs their cries.
Then the full, tragic consciousness of their situation is thrust upon them. Death is reaching out towards them in a new and frightful form that they can only helplessly wait for, powerless against the irresistible, unconquerable forces of nature, against the unconquerable weapon of the winter cold.
The storm incessantly trumpets in their ears: here you must die –, die –
And their fear of death becomes a helpless resignation to their fate.
No one has said it in words, all have come to the thought together at the same time. They climb awkwardly back into the wagons as best they can with their stiff limbs, close by one another, there to die.
They hope for help no longer.
They cuddle up to one other, each to the one they love the most, to be united in death. Outside the storm is singing its eternal song of accompaniment, a song of death, and the flakes build a great, shimmering coffin around the wagons.
And slowly death comes upon them. Through all the corners and pores the icy, piercing chill flows in, like a poison that calmly, sure of success, takes hold of one member after another . . .
The minutes pass slowly by, as if they want to give death enough time to complete its task . . .
Long, heavy hours go by, every one of which carries off despairing souls into eternity.
The storm sings out gaily and laughs in wild mockery at this everyday drama. And the moon unthinkingly spreads its silver over life and death.
In the last wagon there is deep silence. Some are already dead, others are in a state of hallucination that somehow renders death more attractive to those dying. But all are still and lifeless, only some thoughts are still shooting about like hot bolts of lightening . . .
Joshua is holding his fiancée with cold fingers wrapped around her. She is already dead, but he doesn’t realize it yet . . .
He is dreaming . . .
He is sitting with her in the room thoroughly warmed by soft currents of air; the golden candelabrum is flaming with its seven candles, and they are again sitting around it all together as before. The gleam of the joyful feast is reflected in their smiling faces that are saying friendly words and prayers. And long-dead people are coming through the main door, his dead parents too, but that no longer amazes him. And they are kissing each other tenderly and speaking familiar words. And ever more people are coming closer, Jewish people in ancient faded costumes and robes, and heroes are coming, Judah Maccabee and all the others; they are sitting down with them and are talking and are gay. And more are always arriving. The room is full of forms, his eyes are becoming tired by the mass of people who are continually wandering around ever more and more rapidly and pushing into one another, his ear is buzzing with the whirl of noises. His pulse is pounding and hammering, heavier, ever heavier . . .
And suddenly all is quiet, it is over . . .
Now the sun has risen and the snowflakes, that are still continually swirling about, glow like diamonds. And the broad mound covered with snow that has arisen overnight from the plain is glimmering as if covered in precious stones.
It is a strong, cheerful sun, almost a Lent sun, that has suddenly begun to shine. And in fact spring is not far off. Soon it will make everything crisp and green again and will remove the white linen from the grave of the poor, lost, frozen Jews, who have never in their lives known a springtime . . .
2. THE CROSS
It was in the wartime year of 1810. A huge cloud of acrid smoke rolled over the main road towards the Catalonian town of Hostalrich that the Spanish had so heatedly defended and the French so incessantly attacked. From time to time a light waft of air tore a rent in the white covering from which emerged shadowy, heavy wagons, loosely grouped soldiers and tired horses grinding forwards – a supply train under the protection of an experienced colonel and his troops. Sinuous and oblique, the white road snaked along clammy soil in the hilly countryside up towards a small wood that flamed violet with its outer rim reddened under the setting sun. The cloud of dust had already reached the shadow of the trees that silently waited the arrival of the creaking convoy of wagons.
Suddenly a shot rang like a rocket out of the obscurity. Clearly a signal. A second later murderous bursts of rapid fire rained down on the convoy that had been cut in two. Soldiers fell left and right before they had time to seize their rifles, and the frightened horses rose up neighing so that the wagons overturned or rammed into each other. With a glance, the colonel took in the situation: resistance was madness, flight dangerous. His voice rang out like a trumpet over the din. He ordered an attack on a flank, abandoning the transport wagons and the wounded to the enemy. The drumrolls rattled frenetically under the feverish hands of the little drummer, and the French sprang impetuously and irresistibly in disorder against the left side of the road into the wood, that bizarrely began to be full of life. Flashes blazed down out of the treetops, that swayed under the unaccustomed weight, dark forms streaked down like black snakes and sometimes a dull mass fell like a ripe fruit from the angry, swinging branches. Spaniards who had been squatting in the bushes fled before the blindly-striking bayonets of the French, who swept desperately forward towards the clearing in the heights. All the time there were the clamour of shots and cries that resonated in terrifying echoes. At their head, pistol and sword in hand, the colonel stormed forward. Suddenly his arm flew up in the air with fist clenched. His foot had caught in a root and then, as he fell, his head smashed so heavily against a tree trunk that he fell unconscious into the darkness of a bush, whose leaves whipped back into place to envelop him completely. The struggle swept on past the unconscious man.
When the colonel opened his eyes again everything was dark and silent. Over him the branches swayed in the evening dusk, the air was filled with muffled rustling. When he tried to raise his head up he felt blood on his lips. With precaution he ran his hands over the welts that the whip-like branches had raised on his face during his fall. And straightaway the memory of what has happened came back to him. The wind clearly carried from the site of the attack the unmistakable noise of harnessed horses and wheels rolling into the distance. Clearly the victorious guerrillas were taking their booty away. Already a dull pain mingled with his first thoughts: the colonel realized that the control of his destiny had slipped out of his hands and now was more a question of chance. He was alone in an unknown forest, alone in enemy territory. A reflection from his sword, the cracking of a twig in the underbrush could betray him, a defenceless booty to be tortured by the rebels. For ever since Augereau had strewn the route with improvised gallows, ever since Spaniards had been executed in masses without due process of law, the French had found horrible traces of revenge in abandoned villages: the blackened bodies of soldiers burnt slowly over a fire, the decaying corpses of impaled prisoners, frightening images of agony endured and animalistic cruelty. All that flashed through his head so quickly, so crudely, that he shuddered as if shaken by a fever. The foreboding forest that surrounded him rustled ever more sombrely.
The colonel reflected, rejecting impulsive decisions. Only flight was possible, flight by night out of the wood, flight either to Hostalrich or back up the road until he encountered other French troops. But, he felt, he must flee at any price, so strongly did the thought of his pitiful defencelessness burn through his consciousness. But the feeble light that still lingered over the treetops condemned him for the moment to inactivity. Now, lying immobile under the bush with grim lips and blazing eyes, he would have to wait, to wait until the round disk of the moon that was penetrating with a glowing green halo through the evening fog rose up into the sky; he had to listen attentively to every vibration of the earth, every trembling movement of the air, ever bird cry from the depths of the forest, every moan in the branches shaken by the evening wind. Memories of the interminable Egyptian nights filled him with horror, memories of that sulphurous yellow night sky brimming with unbounded silence and unnameable menace. The full weight of the hopelessness of his forsaken situation hung upon his consciousness.
Finally after hours and hours, when the forest seemed to be frozen in the cold moonlight, he cautiously crept on his knees back to the site of the attack, trembling not so much from fear as from a fever of uncertain expectancy. With infinite precautions that were terrible torture for his state of excitement he felt his way forward on all fours through the matted shrubs and the solid network of tree roots. The way from tree to tree took an eternity. Finally the road, as bright as a pond in the moonlight, shone in front of him in the sleepy gloom of the trees bordering the road.
Breathing heavily he got up to hurry over to the abandoned way, pistol in hand and sword at the ready. Then – he pulled himself together – a shadow moved just before him. And came back again. And again there and back, vaguely and yet palpably like a cold breeze.
The colonel gripped his pistol and stared into the darkness of the wood. But no noise came out. And yet: the shadow crept steadily again over the gravel on the road, and restively, eerily, went back out again. Went back and forth like a pendulum, secretly and silently, a ghost in the night. Breathlessly the colonel continued on his way. And was suddenly chilled as his eyes turned up towards the moonlight.
Just above his head, on the forward-leaning branch of a young cork tree, hung a naked body, pale and shimmering gruesomely in the chalky glare of the moon. Swinging in the peaceful rhythm of the shadows on the road. And as his shocked glance went from tree to tree, the horrible sight was multiplied. Dead, tied up in the shadows of the treetops and only faintly visible in the ghostly twilight, seeming to wink and nod with fantastic gestures, the pale corpses swung restlessly back and forth in the wind. His breath rattled out from the colonel’s throat as he looked at the twisted faces of his soldiers, mockingly covered with their bearskin caps. His brave soldiers, with whom he had only yesterday joked over the watch fire, hung like plucked, eviscerated chickens, strangled by brigands, by thieves, by Spaniards, first assassinated and then martyred, despoiled, spat upon! Tottering from rage he sprang up and in a crazed rage to do something pounded his fists against the hard tree trunks. And threw himself down again with teeth clenched, ripping out and crushing up roots, feverish in the torment of his defencelessness, burning with the desire to do something, to roar out, to strike, to throttle, to murder. He was overtaken by an atrocious, burning upsurge of rage and despair. And always those shadows over the road and that muffled rustling of the woods! For the first time in many years the Colonel felt his eyes burning with tears, for the first time the name of Napoleon left his lips with a curse, that he had sent him to this country of murderers and mutilators of corpses. And this was all jumbled up by his feverish, stunned rage. It swelled up like fire in his hands.
Over there, suddenly, a noise! A footstep . . . Blood and heavy breaths, fever and rage, thoughts and feelings stormed through him in a second of expectancy. And truly, steps were approaching. Already there was a shadow between the trees over there where the road curved into the wood. Instinctively he huddled down in the dark, his weapons avidly at the ready, his chest breathing heavily and with jubilation as he recognized a Spaniard in the fleeting moonlight. A messenger perhaps, a shepherd, a marauder, a straggler, a peasant, only a beggar perhaps – but – something shone and moved in his hands: a Spaniard, a murderer, a swine. Rage and willpower feverishly combined with one objective. He let the lurking Spaniard advance one more step, then threw himself with a muffled cry of rage on the terrified man, grasped his throat convulsively with his left hand, tightly throttling his startled cry with the edge. And then – calmly looking grimly into the bulging eyes of the death-spasm – he plunged his knife into his victim’s back, slowly at first, grimly and sufficiently savouring. And then in a burst of rage again and again, quicker and quicker in the back and throat, stronger and stronger, until finally the blade, glancing off a vertebra, drove into his own hand. The pain and the flowing of warm blood brought his rage under control. With a gesture akin to disgust he shook the body away from him so that it tumbled, spinning, onto the ditch and fell beyond with a dull sound.
With a single deep breath he inhaled the cool night air. He felt wonderfully liberated. He no longer felt anger, anguish, fear, regret, fervour – only the cool, so cool, moon-cool, fully-swollen air that the softly rising breeze coursed over his lips. Force, courage and quick reasoning ran through him who was once again a colonel of Napoleon. Calmly and surely his thoughts turned from the past to the future. The corpse of the dead man that he had so quickly killed in a blind rage would betray him, that he foresaw clearly. As he bent over the distorted face that in the varying moonlight almost seemed to be moving like a living ghost, the glassy eyes were staring at him with with an uncanny expression. But the Colonel felt neither fear nor regret, not even a sudden shudder of momentary horror. Steadfastly he took hold of the corpse, pulled it through the resisting bushes to the hiding-place that had already protected him, and threw the body heavily into the grove. He breathed steadily. No turmoil was churning through his body, but he began to feel tired after the tension of so many terrible hours. The morning could no longer be far off, for already the moonlight in the bushes was beginning to wane. So he gave up thoughts of flight. And without thinking about another plan, he threw himself down on the ground, scarcely two strides away from the corpse, obeying only his feelings of exhaustion. And slept deeply and heavily, like those Italians and Austrians united in death on the field of battle.
Waking up in the golden light of a cloudy morning after this night of horror, the Colonel, shivering in the early frost and throttled by a bitter pressure on his neck, considered his desperate situation. Recognisable as a soldier, not knowing the language, he didn’t dare take a step out of this wood that surrounded him. He had to wait, sedately to wait there until evening, he had to hope for a troop of French soldiers passing by, for something unheard-of, improbable. Slowly, like an animal gnawing at him, another voice rose up within him, unruly and excruciating: hunger was tearing at his insides. And thirst was burning his lips. A frightful day of torment began; thoughts, burning acridly like the moisture of the earth that he sucked up from torn-out roots, furrowed into his brain. He played restlessly with his loaded pistol that could end everything. Only the pain, the pride of finishing like an animal in the wild, uselessly, without struggle, far from his troops, withheld his finger from the trigger. In a dull state of terror he remained stretched out for hours on end, for the eternity from morning to evening. Round about him, life continued in its arrogantly tranquil pace; there were from time to time sounds from the road of passers-by that for an instant filled him with horror, but then hours followed filled only with the roar of the wind and the rustling of the branches in the trees. No one came by to take away the barriers of his invisible prison; like a man wounded in the field of battle groaning under the empty sky, he remained lying there in the wood with flabby hands and a burning forehead, sweltering under the rising sun.
Finally after hours of senseless anguish the rays of the sun became more oblique. The evening came, and with it a desperate decision. With a sudden gesture the Colonel tore off his clothes and threw them into the gloom. Then he groped with his fingers through the mass of leaves to where the murdered Spaniard lay on his face, pulled them away and, piece by piece, took off all his clothes and tore the bloody cloak away from the death-cramped hand. And without a tremor, urged on by his final immovable resolve, he dressed himself in the Spanish outfit, the cloak hanging down his back with the broad trace of blood, still damp, that had flowed over it. This way he could flee, he could beg for his bread, could relieve the burning, choking hunger that tore at him, could escape from this net of horror, this forest of death. He wanted to live among men, not like an animal among corpses, harassed by fear and hunger; he wanted to rejoin his army, his Emperor, be it at the cost of his honour. A sob hung in his throat as he saw his uniform lying there like a corpse, the uniform that he had worn through twenty battles, that had been to his soul like a mother with her child. But hunger drove him forth, onto the road, into the twilight. As he turned back one last time for a farewell he perceived through the glint of his tears something gleaming like an eye. It was his Cross of Honour, that Napoleon himself had awarded him on the field of battle. With his bloody dagger he cut it off and hid it in his pocket. And went on, pushed himself forwards, hurried, rushed onto the road.
He knew that scarcely a mile from the wood there was a small, desolate village. His company had stayed there, and he thought uncomfortably – tormented by his raging hunger and the hammering of blood in his temples – of the circular well on the central square where the horses had drunk. The dark face of the Spaniard with its barely-restrained arrogance also rose up in his mind, but everything, absolutely everything was dissolved in the one single feeling: hunger! And so he hurried almost tottering along the already-darkened country road, his face deeply marked by the effort, he hurried and hurried, to overcome the hunger by the effort of hurrying, he hurried with much wheezing until he finally saw the houses, narrow and interlaced, rising out of the diminishing evening gloom. He groped his way to the plaza and at first let the gushing water run down his throat, and plunged his hands and his burning forehead in its coolness. A moment of well-being ran through him for the first time in so many hours. But in the next instant he felt hunger again racking his body like a fist, it pushed him on ahead to the nearest door. Feverishly he knocked on the brittle wood. An old woman, her yellowish face traversed by wrinkles, looked out at him through the half-opened doorway with angry, mistrustful eyes. He indicated his status of deaf-mute by pointing to his lips and made pleading gestures. His soldier’s heart was dead in that second, buried in the wood over there with his sword and his uniform. The woman turned away in refusal and started to shut the door. But the famished man, as if overwhelmed by the oily odour of food that wafted through the vapourish atmosphere of the house, forgot all his pride, now was no more than an animal in his furious urgency, and took hold of the frightened, retreating woman’s arm to implore her. A flare of insanity flamed abruptly in his eyes. Instead of answering, she launched the massive door against the forehead of the intruder, so that he staggered back in a daze. A savage French swearword flew out from his lips: horrified, the Colonel looked around. Thank God, no one had heard him; he could continue to go on begging as a deaf-mute. And he did so, did it with a burning feeling of shame; he went from house to house until finally he had in his hand some lumps of gold-brown bread and five or six moist olives. With greedy impulsions he gobbled it all down, ridding himself of hunger, disgust and shame all together, and ate like an animal with dulled eyes and a twisted face. Before he had passed by the last blackened hovel of the little village, his hands were empty.
A terrible question arose again along with the encroaching shadows of the night. Where to go now? He had wanted to flee back along the way that the column had come. But now he had lead in his feet. All his alertness was shattered. Since he had put on the foreign clothes and had gone begging from house to house, courage and audacity had left him; all his will to live had become enfeebled and listless. Dulled sleepiness filled his entire being. And unconsciously he went back again into the woods that swallowed him up, that seemed to hold him and to draw him on with its secret power. The road that he had previously gone along with his soldiers cheerfully and without care led him back into the wood, where death had been lying in wait for them, where it was still lurking between the black, ghostly-rustling branches. But he was driven on as in a dream. The need to rest, just to rest, to dissolve himself in the languor of rest overwhelmed him in the gloom of the woods. He climbed with difficultly up the embankment and let himself sink down helplessly, without thinking, right on the edge of the road. He dared not go any further, to avoid having to look at the corpses of his dead companions, to avoid seeing his soldier’s uniform again, that bloody rag that lay arrogantly there in the shadows, to avoid seeing the intimation of death it symbolised. As devout as a priest, he pressed the cross of honour in his pocket. It was his cheer, his claim, his hope.
And the night began again, the second, frightful night, a moonlit night with a great many cold stars, with the dreariness of a clear, arched, endlessly still firmament, that cast its heavy loneliness down upon him. The Colonel stared with his tearless, burning, crazed eyes at the road that stood out white there against the insensitive darkness. What would come along this road? Hope, liberation, friends? A stagecoach perhaps, that would take him along, or French troops? But all these thoughts were mixed together in a great muddle, interleaved with the rustling of the leaves in the gloom, the far-off twinkling glitter of the stars and the gleaming rays of the moon. He lay in this solitary wood like in a grave.
In the early morning a shrill call woke the Colonel from his sleep. A bird’s cry, seemingly, dreamily piercing through the web of morning haze. But then again – was it not a bizarre dream? – no, quite sharp, very clear, the warning sound of a horn, a trumpet signal of oncoming troops . . .
His blood rose in a sudden surge. Could that really be French troops, friends, rescuers? Could he really return to the land of the living? Impossibly crazed jubilation rose from his throat. He sprang up – and there, on the road, he saw them coming along, troops of French soldiers in loose columns; he saw the caps, the sabres, the banners, the canons. A relief corps for Hostalrich, certainly.
Then he sprang forward, jubilation overriding all caution. Forgetting his destiny, the danger, the suffering, stumbling in his crazed excitement, he rushed towards the liberators whirling his cloak about him in greeting and with the other hand holding his pistol. And a shriek, an animalistic shriek of inhuman jubilation burst from him into the air, broke out over the morning.
As he stormed through the glade, the inevitable happened. Two, ten shots – a whole salvo – martyrised the apparent Spaniard who – still careening forward in a heated run – hesitated, staggered and fell down streaming blood. The battalion quickly formed itself. They waited for the expected onslaught, signals rang out, trumpets blared. And then complete silence. All had arms at the ready, stood solidly in expectation, waited with bated breath. But no enemy showed himself, and the scouts that had been sent forward declared that nothing was there. Then the battle formation was relaxed. Without thought of an error – it was only a Spaniard – the soldiers shouldered their guns and the column advanced into the wood towards Hostalrich.
Just a few soldiers left ranks to plunder the corpse. Paying no attention to the moans of the dying man, the soldiers tore off his clothes and searched the pockets. And a boundless anger overtook them when they found the Cross of the Order in a bloody handkerchief in the man’s pocket. A Napoleon’s Cross in the pocket of the Spanish bandit! With bitter kicks they smashed at the apparent murderer’s head with their boots, hammered the naked corpse with enraged blows and, swearing, stomped on his body; then they flung the corpse of the unlucky man into the field so heavily that, with arms swinging wildly in the air, he fell down spread-eagled as a monstrous bright cross, clear against the black, scorched stretch of meadow.
3. THE WEDDING IN LYON
On the 12th of November 1793, Barère presented to the French National Convention the fatal decree against the separatist and eternally rebellious Lyon that ended with the lapidary words: “Lyon is fighting against liberty, Lyon no longer exists.” He declared that the buildings of the rebellious city must be levelled, its monuments be reduced to ashes and that its very name had to be eliminated. The Convention hesitated for eight days to approve such complete destruction of France’s second biggest city, and even after its ratification their delegate Couthon, assured of the secret backing of Robespierre, only reluctantly carried out the order worthy of Herostratus [2]. To maintain appearances he convened the population with the greatest pomp to the Place de Bellecourt and symbolically tapped with a silver hammer on buildings to be destroyed; but the shovels only brought down a few of the splendid facades, and the muffled sound of the terrible guillotine on its downward journey was rarely heard. Reassured by this unexpected mildness, the city, that had terribly suffered from the civil war and the months-long siege, begin timidly to hope again when suddenly the humane, scrupulous tribune was recalled and in his place Collot d’Herbois and Fouché appeared in the Liberated City – for that was the name of Lyon from now on in the decrees of the Republic – with their official scarves proudly in evidence. Then what had been thought of as just a simple decree designed to frighten them became overnight grim reality. “Nothing has been done up to now” declared impatiently the first report of the new tribunes to the National Convention, to demonstrate their patriotic energy and to incriminate their less zealous predecessor, and then began the terrible executions that Fouché, the “mitrailleur de Lyon” [3], did not like to be reminded of during his later career as the Count of Otranto and defender of legitimacy.
Instead of the spades that were slowly performing their demolition work, explosive mines now brought down whole series of splendid buildings; instead of the “unreliable and inadequate” guillotine, mass fusillades and grapeshot eliminated hundreds of condemned with a salvo. Spurred on daily by new and more incisive decrees, justice mowed like a scythe far and wide its enormous harvest of victims, day after day, the quick-flowing Rhône had long been used to overcome the too-lengthy business of digging graves and burials, and the prisons could no longer house all of the suspects. So the cellars of official buildings, schools and convents were used to provisionally house the condemned, but only momentarily, as the scythe mowed quickly and straw rarely warmed the same body two nights in a row.
On a sharp, frosty day during those bloody months a troop of condemned prisoners was led into the cellar of the city hall to become one of those tragically short-lived communities. At noon they had been taken one after the other before the commissioner and their fate had been sealed during a brief interrogation; now the sixty-four condemned men and women were sitting in disorder in the low-vaulted, gloomy darkness that reeked of wine barrels and moss and that a pitiful chimney-fire in the front room coloured more than it heated. Most had lethargically thrown themselves down on the straw, others were hastily writing good-bye letters in flickering candle-light on the one wooden table that has been left there, as they knew that their lives would come to an end sooner than the candle whose bluish smoke quivered in that frigid room. No one spoke other than in whispers, and so the sound of the muffled explosions of the mines in the streets above and the subsequent collapse of the houses penetrated clearly into the frozen silence of their cell. Already the stunning rapidity of events had eliminated all capacity for emotion and clear thinking in them; most lay immobile and silent in the gloom like in an ante-chamber of their grave, waiting for nothing and no longer turned towards world of the living.
At about seven o’clock in the evening sharp, energetic steps were suddenly heard at the door, rifle-butts clanged and the rusty latch slid open. Instantly they were all startled: could it be that instead of the sad custom of being granted one last night their last hour has already come? In the cold draught of the open door shone the bluish light of a candle that seemed to leap out as if it wanted to flee its wax frame, and its flickering cast the fear of the unknown on them all. But soon the sudden disquiet was calmed; the prison-master was only bringing in a new group of condemned prisoners, some twenty of them, that he escorted wordlessly down the stairs into the over-crowded room without indicating any particular place for them. Then the heavy iron door slammed shut again.
The prisoners cast unfriendly glances on the newcomers, for oddly enough human nature is able to rapidly adapt everywhere, and even in flight is able to feel at ease and in one’s right. So the earlier arrivals already quite instinctively considered the dank, musty room, the mouldy straw and the space around the fire as their property, and each one of the new prisoners to be an unwelcome and annoying intruder. The new arrivals for their part clearly perceived the cold hostility of their predecessors, senseless as it was in such mortal circumstances, and then – surprisingly – they exchanged no greetings or words with those who would share their fate, did not demand a place at the table or on the straw, but just sullenly and wordlessly pressed into one of the corners. And the cruel silence that already reigned under the vaults weighed even more heavily because of the tension of this senseless atmosphere of challenge.
Then a cry rang out that was all the more striking in this silence, a strong, clear, almost trembling cry sounding as if it came from another world, that irresistibly tore even the most indifferent from their lethargy and depression. A young woman who had just arrived with the others had suddenly and tremblingly sprung up in a bound with arms outspread like one about to fall down, and was vibrantly crying out “Robert, Robert!” towards a young man who had been standing apart from the others leaning on the barred window, and who now was rushing towards her. And already like two flames of a single fire these two young people had thrown body on body and mouth on mouth with such burning intensity that the tears already streaming down their faces flowed onto the other’s cheeks and their sobs sounded as if they were bursting from a single throat. When they released each other for an instant, incredulous at being reunited and amazed by it, in the next instant they pressed themselves together again in a new embrace as tightly glued to each other as possible. They cried and sobbed and talked and shouted in one breath, all alone together in the bottomless depth of their feelings and completely unconscious of the others, who, astonished and intrigued, gathered uncertainly closer around the couple.
The young woman had known Robert de L..., the son of a senior magistrate, since her childhood and had been engaged to him for several months. The banns had already been proclaimed in the church, and their wedding had been planned just on that terrible day when the troops of the Convention had invaded the city, obliging her fiancé, who had fought with “Percy’s Army” against the Republic, to accompany the royalist general in his desperate break-through. For weeks there had been no news of him and she had already begun to hope that he had been able to escape over the Swiss border, when suddenly a city scribe told her that informers had discovered his hiding-place in a farm and that he had been brought before a revolutionary tribunal the day before. As soon as the plucky young woman learned of the imprisonment and certain condemnation of her fiancé, with that magical and inexplicable energy that nature has endowed women in the moment of their greatest danger, she achieved the impossible and managed to gain access to the inaccessible deputy of the Republic in person to beg for grace for her fiancé. Collot d’Herbois, at whose feet she had thrown herself, had sharply rejected her, for he had no pity for traitors. At that she hurried over to Fouché, who was no less harsh than the other but cleverer in his manner, and who resisted the emotion that the sight of this despairing young woman aroused in him by lying, telling her that he would willingly intercede in favour of her fiancé, but that he saw – and the adroit manipulator glanced vaguely through his eyepiece at whatever paper on his desk – that already that same morning Robert L... had been shot by a firing squad on the Plains of Brotteaux. The crafty deception of the young woman was completely successful: she was immediately convinced of the death of her fiancé. But instead of giving herself over to an innocuous womanly mourning, indifferent to her now-meaningless life she tore the revolutionary emblem from her hair, stamped on it with her feet, shouted in a resounding voice that could be heard throughout all the open doors that Fouché and all his men who had rapidly come to the scene were miserable bloodsuckers, hangmen and cowardly criminals. And as she was being seized by the soldiers and taken out of the room she could already hear how Fouché was dictating her sentence to the pock-marked secretary.
All this she had no longer experienced as something real and essential, the impassioned young woman explained almost gaily to those around her, but, on the contrary, an onrushing feeling of liberation had taken hold of her at the thought of quickly following in the footsteps of her executed fiancé. During her interrogation she hadn’t replied to any of the questions, she was so strongly rejoicing at the approaching end, and she hadn’t once looked up when she had been led into this prison with the group of late arrivals. For what could interest her any more in this world now that she knew her beloved to be dead, and that she herself was soon going to be blissfully near him in death. So she had just installed herself in a corner without paying attention to anyone until her glance, scarcely accustomed to the gloom, had been struck by the attitude of a young man leaning thoughtfully against the window with a dreamy kind of look, most astonishingly similar to the manner of her beloved. Although she had strictly forbidden herself to harbour any such senseless, fallacious hopes, she nevertheless stood up in a bound. And almost simultaneously he had entered the circle of light of the candle. But she couldn’t understand, she added, still under the shock, how she hadn’t died in that shattering moment of surprise, for she had clearly felt her heart springing like a living thing from her breast as she uttered the piercing cry that was still echoing in the room when she had suddenly seen him, whom she had long given up for dead, alive there before her.
While she was recounting this all in a rush her hand did not heave her loved one for an instant. Steadfastly, as if she were still uncertain of his presence, she continually pressed herself back into his embrace, and the moving sight of this juvenile intensity shook their fellow prisoners in a quite wonderful way. Although they had felt lethargic, tired and indifferent until then, incapable of any emotion, they all crowded now around the miraculously reunited couple with passionate animation. Everyone forgot their own fate in face of this extraordinary event, everyone gave in to the impulsive urge to express a word of solidarity or encouragement or even pity to them, but in a kind of onrushing pride the fiery young woman rejected every expression of regret. No, she was happy, unreservedly happy now that she knew that she would die at the same time as her beloved, and that neither would have to mourn the other. And only one thing diminished her happiness: that she still bore another name and could not appear before God with him as his betrothed wife.
She had said that quite guilelessly, without any particular intention, and she was so intent on pressing herself to her lover that she already had almost forgotten her words; so didn’t notice that a comrade-in-arms of Robert, deeply moved by her remark, had for the moment gone aside and begun to whisper softly to an older man. The whispered words seemed to greatly affect the other man, for he quickly gathered himself up and went over to the couple. He told them that in spite of his peasant clothes he was in fact a refractory priest [4] from Toulon, and that he had been arrested following a denunciation. But although he was now without his priestly gown, he felt quite undiminished in his religious prerogatives and in his powers as a priest. And as the banns had been published for the couple long beforehand, and that on the other hand their condemnation would allow no postponement, he would therefore willingly undertake to consecrate their declared desire and join them in holy matrimony before the universal God, with their fellow companions here as witnesses.
Astonished by this renewed and unhoped-for fulfilment of her dreams, the young woman glanced questioningly at her fiancé. He replied with a piercing glance. The young woman then kneeled down on the hard tiles, kissed the hand of the priest and asked him to perform the marriage even in this unworthy space, for she felt herself filled with pure sensations and penetrated with the holiness of the occasion. The others, deeply shaken by the realisation that this musty room of death would for a time become a church, were instinctively moved by the emotion of the bride and hid their feelings with various hasty activities. The men put the few chairs that there were in a row and installed the wax candles around an iron crucifix so that the table was like an alter; the women rapidly gathered up the few flowers that pitying hands had given them on their way there into a small wreath, that they placed on the head of the bride; while the priest had gone into the entrance-way with the bride and groom and had confessed first him and then her; and as the couple approached the improvised altar there was such a complete and surprising silence for several minutes that the soldier on guard outside, suspecting something suspicious, opened the door and came in. When he perceived the unusual proceeding, his dark peasant face instinctively became serious and respectful. He stood immobile at the door, and remained there as a silent witness throughout the unusual wedding ceremony.
The priest advanced to the table and explained in a few words that there was a church and an altar everywhere where people wanted to be joined in humility to God. Then he kneeled down and all present kneeled down with him; it was so still that none of the little flames flickered. In the silence the priest asked if the two wanted to join together in life and in death. With a firm voice they answered: “In life and in death”, and that word “death” – even until then charged with terror – rang throughout the silent room brightly and clearly and no longer trembling with notions of fear.
Then the priest joined their hands together and pronounced the binding words: »Ego auctoritate sanctae matris Ecclesiae qua fungor conjungo vos in matrimoniam in nomine Patris et Filii Spiritus sancti.« [5]
With that the ceremony was over. The newlyweds kissed the hand of the priest and all of the other prisoners pushed forward to say a few heartfelt words to them. No one in that moment thought of death, and those who had been dreading it no longer felt its horror.
In the meantime the friend, who had served as witness to the marriage, had been softly whispering with some of the others, and soon a certain activity was seen to be underway.
The young woman blushed to the roots of her hair, but her husband looked frankly into the eyes of the friend and firmly shook his brotherly hand. They did not speak a word, and only looked at one another. And so, without any spoken word of command, the men grouped themselves around the groom and the women around the bride and accompanied them with uplifted candles into the chamber that had been borrowed from death, unknowingly rediscovering the original wedding custom in the depths of their impulse of solidarity.
Then they softly closed the door behind the married couple, and no one dared to utter an unbecoming remark or pleasantry about this marital intimacy so close by; for a strange, solemn emotion had quietly deployed its wings over them all, because, powerless in face of their destiny, they had nevertheless been able to grant to others a handful of happiness. And secretly everyone was thankful for the beneficial distraction from their own unavoidable fate. So the condemned lay there dispersed in the darkness on their bales of straw until early morning, awake or dreaming, and only rarely did a few sighs echo throughout the crowded space.
When the soldiers arrived the next morning to take the eighty-four condemned men and women to the execution ground, they found everyone already awake and fully prepared. Only in the adjoining room, where the married couple were lingering, was everything still: even the harsh echos of the rifle butts had not awoken the tired couple. The best man quietly hurried in so that it wouldn’t be the executioner who would awaken them. They were still locked in deep embrace, her hand negligently under her husband’s arched neck as if forgotten there; even in the soft torpor of sleep their relaxed faces glowed so blissfully that it was hard for the companion to disturb them. But he dared not linger and woke the husband first with an urgent appeal, who, glancing dizzily up, understood the situation in an instant and tenderly lifted his wife up from her resting place. She looked up, childishly shaken by being so rapidly brought back to the icy reality. Then she said to him with a smile: “I am ready.”
Everyone instinctively made place for them as they came in hand in hand, and so, spontaneously, the newlyweds opened the death march of the condemned prisoners. Although already used to the daily spectacle of those sad columns, the onlookers this time observed the unusual convoy with astonishment, for from the two who led the whole group, the young officer and the woman adorned with her bridal wreath, there shone such an unusual gayness and an almost blissful sureness that even hardened souls felt respect for some special secret. And the other prisoners did not tramp along with the usual hesitant pace of the condemned, but were instead all looking fixedly at the couple whose dreams had been so unexpectedly fulfilled three times; they were staring intensely with a desperately firm conviction that to these two lucky beings once again a miracle would surely come to pass and save them from a certain death.
But while life likes the wonderful it is sparing with true miracles: there only came to pass what happened every day then in Lyon. The column was taken over the bridge onto the marshy plain of Brotteaux where twelve infantry squads awaited them – three muskets for each person. They were placed in line: a single salvo brought them all down. Then the soldiers threw the still-bleeding corpses into the Rhône, whose rapid current swallowed up indifferently the faces and the destinies of these anonymous people. Only the marriage wreath, that had separated from the head of the sinking woman, floated aimlessly and bizarrely for a while on the waves further downriver. Finally it too disappeared and with it for a long time the memory of those who has been rescued on the brink of death for a memorable night of love.
INHALT
3. Die Hochzeit von Lyon (1927)
IM SCHNEE
Eine kleine deutsche Stadt aus dem Mittelalter, hart an der Grenze von Polen zu, mit der vierschrötigen Behäbigkeit, wie sie die Baulichkeiten des vierzehnten Jahrhunderts in sich tragen. Das farbige, bewegliche Bild, das sonst die Stadt bietet, ist zu einem einzigen Eindrucke herabgestimmt, zu einem blendenden, schimmernden Weiß, das hoch über den breiten Stadtmauern liegt und auch auf den Spitzen der Türme lastet, um die schon die Nacht die matten Nebelschleier gezogen hat.
Es dunkelt rasch. Das laute, wirre Straßentreiben, die Tätigkeit vieler schaffender Menschen dämpft sich zu einem verrinnenden, wie aus weiter Ferne klingenden Geräusche, das nur der monotone Sang der Abendglocken in rhythmischen Absätzen durchbricht. Der Feierabend tritt seine Herrschaft an über die abgemüdeten, schlafersehnenden Handwerker, die Lichter werden immer vereinzelter und spärlicher, um dann ganz zu verschwinden. Die Stadt liegt wie ein einziges, mächtiges Wesen im tiefen Schlafe.
Jeder Laut ist gestorben, auch die zitternde Stimme des Heidewindes ist in einem linden Schlafliede ausgeklungen; man hört das leise Lispeln der stäubenden Schneeflocken, wenn ihre Wanderung ein Ziel gefunden ....
Plötzlich wird ein leiser Schall vernehmbar.
Es ist wie ein ferner, eiliger Hufschlag, der näher kommt. Der erstaunte schlaftrunkene Wächter der Tore geht überrascht ans Fenster, um hinauszuhorchen. Und wirklich nähert sich ein Reiter in vollem Galopp, lenkt gerade auf die Pforte zu, und eine Minute später fordert eine rauhe, durch die Kälte eingerostete Stimme Einlaß. Das Tor wird geöffnet, ein Mann tritt ein, der ein dampfendes Pferd zur Seite führt, das er sogleich dem Pförtner übergibt; und seine Bedenken beschwichtigt er rasch durch wenige Worte und eine größere Geldsumme, dann eilt er mit hastigen Schritten, die durch ihre Sicherheit die Bekanntschaft mit der Lokalität verraten, über den vereinsamten weißschimmernden Marktplatz hinweg, durch stille Gassen und verschneite Wege, dem entgegengesetzten Ende des Städtchens zu.
Dort stehen einige kleine Häuser, knapp aneinandergedrängt, gleichsam als ob sie der gegenseitigen Stütze bedürften. Alle sind sie schmucklos, unauffällig, verraucht und schief, und alle stehen sie in ewiger Lautlosigkeit in den verborgenen Gassen. Es ist, als hätten sie nie eine frohe, in Lust überschäumende Festlichkeit gekannt, als hätte nie eine jubelnde Freude diese erblindeten, versteckten Fenster erbeben gemacht, nie ein leuchtender Sonnenschein sein schimmerndes Gold in den Scheiben gespiegelt. Einsam, wie verschüchterte Kinder, die sich vor den andern fürchten, drücken sie sich zusammen in dem engen Komplex der Judenstadt.
Vor einem dieser Häuser, dem größten und verhältnismäßig ansehnlichsten, macht der Fremde Halt. Es gehört dem Reichsten der kleinen Gemeinde und dient zugleich als Synagoge.
Aus den Ritzen der vorgeschobenen Vorhänge dringt ein heller Lichtschimmer und aus dem erleuchteten Gemache klingen Stimmen im religiösen Gesang. Es ist das Chanukafest, das friedlich begangen wird, das Fest des Jubels und des errungenen Sieges der Makkabäer, ein Tag, der das vertriebene, schicksalgeknechtete Volk an seine einstige Kraftfülle erinnert, einer der wenigen freudigen Tage, die ihnen das Gesetz und das Leben gewährt hat. Aber die Gesänge klingen wehmütig und sehnsuchtsvoll, und das blanke Metall der Stimmen ist rostig durch die tausend vergossenen Tränen, wie ein hoffnungsloses Klagelied tönt der Sang auf die einsame Gasse und verweht ....
Der Fremde bleibt einige Zeit untätig vor dem Hause, in Gedanken und Träume verloren, und schwere, quellende Tränen schluchzen in seiner Kehle, die unwillkürlich die uralten heiligen Melodien mitsingt, die tief aus seinem Herzen emporfließen. Seine Seele ist voll tiefer Andacht.
Dann rafft er sich auf. Mit zögernden Schritten geht er auf das verschlossene Tor zu, und der Türklopfer fällt mit wuchtigem Schlage auf die Tür nieder, die dumpf erzittert.
Und das Erzittern vibriert durch das ganze Gebäude fort ....
Augenblicklich verstummt von oben der Gesang, wie auf ein gegebenes, verabredetes Zeichen. Alle sind blaß geworden und sehen sich mit verstörtem Blick an. Mit einemmale ist die Feststimmung verflogen, die Träume von der siegenden Kraft eines Juda Makkabi, dem sie im Geiste alle begeistert zur Seite standen, sind versunken, das glänzende Reich der Juden, das vor ihren Augen war, ist dahin, sie sind wieder arme, zitternde, hilflose Juden. Die Wirklichkeit ist wieder auferstanden.
Furchtbare Stille. Der bebenden Hand des Vorbetenden ist das Gebetbuch entsunken, keinem gehorchen die bleichen Lippen. Eine entsetzliche Beklemmung hat sich im Zimmer erhoben und hält alle Kehlen mit eiserner Faust umkrampft. –
Sie wissen wohl, warum.
Ein furchtbares Wort war zu ihnen gedrungen, ein neues, unerhörtes Wort, dessen blutige Bedeutung sie an ihrem eigenen Volke fühlen mußten. Die Flagellanten waren in Deutschland erschienen, die wilden gotteseifrigen Männer, die in korybantischer Lust und Verzückung ihren eigenen Leib mit Geißelhieben zerfleischten, trunkene, wahnsinnswütende Scharen, die Tausende von Juden hingeschlachtet und gemartert hatten, die ihnen ihr heiligstes Palladium, den alten Glauben der Väter gewaltsam entreißen wollten. Und das war ihre schwerste Furcht. – Gestoßen, geschlagen, beraubt zu werden, Sklaven zu sein, alles hatten sie hingenommen mit einer blinden, fatalistischen Geduld; Überfälle in später Nacht mit Brand und Plünderung hatte jeder erlebt, und immer wieder lief ein Schauder durch ihre Glieder, wenn sie solcher Zeiten gedachten.
Und vor wenigen Tagen war erst das Gerücht gekommen, auch gegen ihr Land, das bisher die Geißler nur dem Namen nach gekannt, sei eine Schar aufgebrochen und sollte nicht mehr ferne sein. Vielleicht waren sie schon hier?
Ein furchtbarer Schrecken, der den Herzschlag hemmte, hat jeden erfaßt. Sie sehen schon wieder die blutgierigen Scharen mit den weinberauschten Gesichtern mit wilden Schritten in die Häuser stürmen, lodernde Fackeln in der Hand, in ihren Ohren klingt schon der erstickte Hilferuf ihrer Frauen, die die wilde Lust der Mörder büßen, sie fühlen schon die blitzenden Waffen. Alles ist wie ein Traum, so deutlich und lebendig. –
Der Fremde horcht hinauf, und als ihm kein Einlaß gewährt wird, wiederholt er den Schlag, der wiederum dumpf und dröhnend durch das verstummte, verstörte Haus zittert. –
Inzwischen hat der Herr des Hauses, der Vorbeter, dem der weiß herabwallende Bart und das hohe Alter das Ansehen eines Patriarchen gibt, als erster ein wenig Fassung gewonnen. Mit leiser Stimme murmelt er: »Wie Gott will.« Und dann beugt er sich zu seiner Enkelin hin, einem schönen Mädchen, das in ihrer Angst an ein Reh erinnert, welches sich mit flehenden großen Augen dem Verfolger entgegen wendet: »Sieh’ hinaus, wer es ist, Lea!«
Das Mädchen, auf dessen Mienen sich die Blicke aller konzentrieren, geht mit scheuen Schritten zum Fenster hin, wo sie den Vorhang mit zitternden, blassen Fingern hinwegschiebt. Und dann ein Ruf, der aus tiefster Seele kommt: »Gottlob, ein einzelner Mann.«
»Gott sei gelobt«, klingt wie ein Seufzer der Erleichterung von allen Seiten wieder. Und nun kommt auch Bewegung in die starren Gestalten, auf denen der furchtbare Alp gelastet hat, einzelne Gruppen bilden sich, die teils in stummem Gebete stehen, andere besprechen voll Angst und Ungewißheit die unerwartete Ankunft des Fremden, der jetzt zum Tore eingelassen wird.
Das ganze Zimmer ist von einem schwülen, drückenden Duft von Scheiten und der Anwesenheit so vieler Menschen erfüllt, die alle um den reichbedeckten Festtisch versammelt gewesen waren, auf dem das Wahrzeichen und Symbol des heiligen Abends, der siebenarmige Leuchter, steht, dessen einzelne Kerzen matt durch den schwelenden Dunst brennen. Die Frauen sind in reichen, schmuckbesetzten Gewändern, die Männer in den wallenden Kleidern mit weißen Gebetbinden angetan. Und das enge Gemach ist von einer tiefen Feierlichkeit durchweht, wie sie nur die echte Frömmigkeit zu verleihen vermag.
Nun kommen schon die raschen Schritte des Fremden die Treppe herauf, und jetzt tritt er ein.
Zugleich dringt ein fürchterlicher, scharfer Windstoß in das warme Gemach, den das geöffnete Tor hereinleitet. Und eisige Kälte strömt mit der Schneeluft herein und umfröstelt alle. Der Zugwind löscht die flackernden Kerzen am Leuchter, nur eine zuckt noch ersterbend hin und her. Plötzlich ist dadurch das Zimmer in ein schweres, ungemütliches Dämmerlicht gehüllt, es ist, als ob sich jäh eine kalte Nacht von den Wänden herabsenken möchte. Mit einem Schlage ist das Behagliche, Friedliche verflogen, jeder fühlt die üble Vorbedeutung, die in dem Verlöschen der heiligen Kerzen liegt, und der Aberglaube macht sie wieder von neuem erschaudern. Aber keiner wagt ein Wort zu sprechen. –
An der Türe steht ein hochgewachsener, schwarzbärtiger Mann, der kaum älter sein dürfte als dreißig Jahre, und entledigt sich rasch der Tücher und Decken, mit denen er sich gegen die Kälte vermummt hatte. Und im Augenblicke, wo seine Züge im Dämmerschein der kleinen, flackernden letzten Kerzenflamme sichtbar werden, eilt Lea auf ihn zu und umfängt ihn.
Es ist Josua, ihr Bräutigam aus der benachbarten Stadt.
Auch die andern drängen sich lebhaft um ihn herum und begrüßen ihn freudig, um aber bald zu verstummen, denn er wehrt seine Braut mit ernster, trauriger Miene ab, und ein schweres sorgenvolles Wissen hat breite Furchen in seine Stirn gegraben. Alle Blicke sind ängstlich auf ihn gerichtet, der seine Worte gegen die strömende Flut seiner Empfindungen nicht verteidigen kann. Er faßt die Hände der Zunächststehenden, und leise entringt sich das schwere Geheimnis seiner Lippen:
»Die Flagellanten sind da!«
Die Blicke, die sich auf ihn fragend gerichtet haben, sind erstarrt, und er fühlt, wie die Pulse der Hände, die er hält, plötzlich stocken. Mit zitternden Händen hält sich der Vorbeter an dem schweren Tische an, daß die Kristalle der Gläser leise zu singen beginnen und zitternde Töne entschwingen. Wieder hält die Angst die verzagten Herzen umkrallt und preßt den letzten Blutstropfen aus den erschreckten, verwüsteten Gesichtern, die auf den Boten starren.
Die letzte Kerze flackert noch einmal und verlöscht ....
Nur die Ampel beleuchtet noch matt die verstörten, vernichteten Menschen, die das Wort wie ein Blitzschlag getroffen hat.
Eine Stimme murmelt leise das schicksalsgewohnte, resignierte »Gott hat es gewollt!«.
Aber die übrigen sind noch fassungslos.
Doch der Fremde spricht weiter, abgerissen, heftig, als ob er selbst seine Worte nicht hören wollte.
»Sie kommen – viele – Hunderte. – Und vieles Volk mit ihnen. – Blut klebt an ihren Händen – sie haben gemordet, Tausende – alle von uns, im Osten. Sie waren schon in meiner Stadt .....«
Ein furchtbarer Schrei einer Frauenstimme, dessen Kraft die herabstürzenden Tränen nicht mildern können, unterbricht ihn. Ein Weib, noch jung, erst kurz verheiratet, stürzt vor ihn hin.
>>Sie sind dort?! – Und meine Eltern, meine Geschwister? Ist ihnen ein Leid geschehen?«
Er beugt sich zu ihr nieder, und seine Stimme schluchzt, wie er leise zu ihr sagt, daß es wie eine Tröstung klingt:
»Sie kennen kein menschliches Leid mehr.«
Und wieder ist es still geworden, ganz still .... Das furchtbare Gespenst der Todesfurcht steht unter ihnen und macht sie erzittern .... Es ist keiner von ihnen, der nicht dort in der Stadt einen lieben Toten gehabt hätte.
Und da beginnt der Vorbeter, dem Tränen in den silbernen Bart hinabrinnen und dem die spröde Stimme nicht gehorchen will, mit abgerissenen Worten das uralte, feierliche Totengebet zu singen. Und alle stimmen ein. Sie wissen es selbst nicht, daß sie singen, sie wissen nichts von Wort und Melodie, die sie mechanisch nachsprechen, jeder denkt nur an seine Lieben. Und immer mächtiger wird der Gesang, immer tiefer die Atemzüge, immer mühsamer das Zurückdrängen der emporquellenden Gefühle, immer verworrener die Worte, und schließlich schluchzen alle in wildem fassungslosen Leid. Ein unendlicher Schmerz hat sie alle brüderlich umfangen, für den es keine Worte mehr gibt.
Tiefe Stille .... Nur ab und zu ein tiefes Schluchzen, das sich nicht unterdrücken lassen will .…
Und dann wieder die schwere, betäubende Stimme des Erzählenden:
»Sie ruhen alle bei Gott. Keiner ist ihnen entkommen. Ich allein entfloh durch Gottes Fügung ....«
»Sein Name sei gelobt«, murmelt der ganze Kreis in instinktivem Frömmigkeitsgefühl. Wie eine abgebrauchte Formel klingen die Worte aus dem Munde der gebrochenen zitternden Menschen.
»Ich kam spät in die Stadt, von einer Reise zurück; die Judenstadt war schon erfüllt mit den Plünderern .... Man erkannte mich nicht, ich hätte flüchten können – aber es trieb mich hin, unwillkürlich an meinen Platz, zu meinem Volke, mitten unter sie, die unter den geschwungenen Fäusten fielen. Plötzlich reitet einer auf mich zu, schlägt aus nach mir – er fehlt und schwankt im Sattel. Und da plötzlich faßt mich der Trieb zum Leben, die unerklärliche Kette, die uns an unsern Jammer fesselt – eine Leidenschaft gibt mir Kraft und Mut, ich reiße ihn vom Pferde und stürme selbst auf seinem Roß in die Weite, in die dunkle Nacht, zu euch her: einen Tag und eine Nacht bin ich geritten.«
Er hält einen Augenblick inne. Dann sagt er mit festerer Stimme: »Genug jetzt von dem allen! Zunächst, was tun?«
Und von allen Seiten die Antwort:
»Flucht!« – »Wir müssen fliehen!« – »Nach Polen hinüber!«
Es ist das einzige Hilfsmittel, das alle wissen, die abgebrauchte, schmähliche und doch unersetzliche Kampfesart des Schwächeren gegen den Starken. An Widerstand denkt keiner. Ein Jude sollte kämpfen oder sich verteidigen? Das ist in ihren Augen etwas Lächerliches und Undenkbares, sie leben nicht mehr in der Zeit der Makkabäer, es sind wieder die Tage der Knechtschaft, der Ägypter gekommen, die dem Volke den ewigen Stempel der Schwäche und Dienstbarkeit aufgedrückt haben, den nicht Jahrhunderte mit den Fluten der Jahre verwaschen können.
Also Flucht!
Einer hatte die schüchterne Ansicht geltend machen wollen, man möge den Schutz der Bürger in Anspruch nehmen, aber ein verächtliches Lächeln war die Antwort gewesen. Ihr Schicksal hatte die Geknechteten immer wieder zu sich selbst und zu ihrem Gotte zurückgeführt. Ein Vertrauen auf einen dritten kannten sie nicht mehr.
Man besprach nun alle näheren Umstände. Alle diese Männer, die es als ihr einziges Lebensziel betrachtet hatten, Geld zusammenzuscharren, die im Reichtum den Gipfel menschlicher Glückseligkeit und Machtstellung sahen, stimmten jetzt überein, daß man kein Opfer scheuen müßte, um die Flucht zu beschleunigen. Jedes Besitztum mußte zu barem Gelde gemacht werden, wenn auch unter den ungünstigsten Umständen, Wagen waren zu beschaffen, Gespann und das Notdürftigste zum Schutze gegen die Kälte. Mit einem Schlage hatte die Todesfurcht ihre nationale Eigenschaft verwischt, ebenso wie sie die einzelnen Charaktere zu einem einzigen Willen zusammengeschmiedet. In allen den bleichen, abgemüdeten Gesichtern arbeiteten die Gedanken einem Ziele zu.
Und als der Morgen seine lohenden Fackeln entflammte, da war schon alles beraten und beschlossen. Mit der Beweglichkeit ihres Volkes, das die Welt durchwandert hat, fügten sie sich dem schweren Banne der Situation, und ihre letzten Beschlüsse und Verfügungen klangen wieder in ein Gebet aus.
Jeder ging, seinen Teil am Werke zu vollbringen.
Und im leisen Singen der Schneeflocken, die schon hohe Wälle in den schimmernden Straßen getürmt hatten, starb mancher Seufzer dahin. .…
Dröhnend fiel hinter dem letzten Wagen der Flüchtenden das große Stadttor zu ....
Am Himmel leuchtete der Mond nur als schwacher Schein, aber sein Glanz versilberte die Myriaden Flocken, die übermütige Figuren tanzten, sich in den Kleidern versteckten, um die schnaubenden Nüstern der Pferde flitterten und an den Rädern knirschten, die sich nur mühsam den Weg durch die dicken Schneemassen bahnten.
Aus den Wagen flüsterten leise Stimmen. Frauen, die ihre Erinnerungen an die Heimatstadt, die in sicherer, selbstbewußter Größe noch knapp vor ihren Augen lag, mit wehmütigen, leise singenden Worten austauschten, helle Kinderstimmen, die nach tausend Dingen fragten und forschten, die aber immer stiller und seltsamer wurden und endlich mit einem gleichmäßigen Atmen wechselten, klangen melodisch von dem sonoren Tone der Männer ab, die sorgenvoll die Zukunft berieten und leise Gebete murmelten. Alle waren eng aneinandergeschmiegt durch das Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit und aus instinktiver Furcht vor der Kälte, die aus allen Lücken und Löchern wie mit eisigem Atem hereinblies und die Finger der Lenker erstarren machte.
Der erste Wagen hielt an.
Sofort blieb die ganze Reihe der übrigen stehen. Aus allen den wandernden Zelten sahen blasse Köpfe nach der Ursache des Stockens. Aus dem ersten Wagen war der Älteste gestiegen, und sämtliche folgten seinem Beispiele, denn sie hatten den Grund der Rast erkannt.
Sie waren noch nicht weit von der Stadt; durch das weiße Geriesel konnte man noch undeutlich den Turm erkennen, der sich wie eine drohende Hand aus der weiten Ebene erhebt, und von dessen Spitze ein Schimmer ausgeht, wie der eines Edelsteines an der beringten Hand.
Hier war alles glatt und weiß, wie die erstarrte Oberfläche eines Sees. Nur hie und da zeigten sich in einem abgegrenzten Baum kleine, gleichmäßige Erhöhungen, unter denen sie ihre Lieben wußten, die hier ausgestoßen und einsam, wie das ganze Volk, fern von ihrer Heimatstatt ein stilles, ewiges Bett gefunden hatten.
Tiefe Stille, die nur das leise Schluchzen durchbricht.
Und heiße Tränen rinnen über die erstarrten, leiderfahrenen Gesichter herab und werden im Schnee zu blanken Eistropfen.
Vergangen und vergessen ist alle Todesfurcht, wie sie den tiefen stummen Frieden sehen. Und alle überkommt mit einemmale eine unendliche, tränenschwere, wilde Sehnsucht nach dieser ewigen, stillen Ruhe am »guten Ort«, zusammen mit ihren Lieben. Es schläft so viel von ihrer Kindheit unter dieser weißen Decke, so viel selige Erinnerungen, so unendlich viel Glück, wie sie es nie mehr wieder erleben werden. Das fühlt jeder und jeden faßt die Sehnsucht nach dem »guten Ort«.
Aber die Zeit drängt zum Aufbruch.
Sie kriechen wieder in die Wagen hinein, eng und fest gegeneinander, denn während sie im Freien die schneidende Kälte nicht verspürt, schleicht jetzt wieder das eisige Frösteln ihre bebenden, zitternden Körper hinauf und schlägt die Zähne gegeneinander. Und im Dunkeln des Wagens finden sich die Blicke mit dem Ausdrucke einer unsagbaren Angst und eines unendlichen Leides ...
Ihre Gedanken aber ziehen immer wieder den Weg zurück, den die breiten Furchen der Gespanne in den Schnee eingezwängt, zurück zum Orte ihrer Sehnsucht, zum »guten Ort«.
Es ist Mitternacht vorbeigezogen. Die Wagen sind schon weit weg von der Stadt, mitten in der gewaltigen Ebene, die der Mond hell überflutet und die von den schimmernden Reflexen des Schnees wie mit weißen, wallenden Schleiern umwoben ist. Mühsam stapfen die starken Rosse durch die dicke Schichte, die sich an den Rändern zäh anheftet, langsam, fast unmerklich holpern die Gefährte weiter; es ist als ob sie jeden Augenblick stehenbleiben würden.
Die Kälte ist furchtbar geworden und schneidet wie mit eisigen Messern in die Glieder, die schon viel von ihrer Beweglichkeit eingebüßt haben. Und nach und nach ist auch ein starker Wind erwacht, der wilde Lieder singt und an den Wagen rasselt. Wie mit gierigen Händen, die sich nach den Opfern ausrecken, reißt es an den Zeltdecken, die unablässig geschüttelt werden und nur mehr mit Mühe von den starren Händen stärker befestigt werden können.
Und immer lauter singt der Sturm und in seinem Lied verklingen die betenden, leise lispelnden Stimmen der Männer, deren eiserstarrte Lippen nur mehr mit Anstrengung die Worte formen können. Unter dem schrillen Pfeifen erstirbt das fassungslose, zukunftsbange Schluchzen der Frauen und das eigensinnige Weinen der Kinder, denen die Kälte den Druck der Müdigkeit genommen.
Ächzend rollen die Räder durch den Schnee.
Im letzten Wagen schmiegt sich Lea an ihren Bräutigam an, der ihr mit trauriger, monotoner Stimme von dem großen Leide erzählt. Und er schlingt den starken Arm fest um ihren mädchenhaften, schmalen Körper, als wollte er sie gegen die Angriffe der Kälte und gegen jeden Schmerz behüten. Und sie sieht ihn mit dankbaren Blicken an, und in das Gewirre von Klagen und Stürmen verrinnen einige sehnsuchtszärtliche Worte, die beide an Tod und Gefahr vergessen machen ....
Plötzlich ein harter Ruck, der alle zum Schwanken bringt.
Und dann bleibt der Wagen stehen.
Undeutlich vernimmt man von den vorderen Gespannen her durch die tosende Flut des Sturmes laute Worte, Peitschenknall und Gemurmel von erregten Stimmen, das nicht verstummen will. Man verläßt die Wagen, eilt durch die schneidende Kälte nach vorne, wo ein Pferd des Gespannes gestürzt ist und das zweite mit sich gerissen hat. Um die Rosse herum die Männer, die helfen wollen, aber nicht können, denn der Wind stößt sie wie schwache achtlose Puppen, und die Flocken blenden ihre Augen und die Hände sind erstarrt, kraftlos, wie Holz liegen die Finger aneinander. Und weithin keine Hilfe, nur die Ebene, die im stolzen Bewußtsein ihrer Unendlichkeit sich ohne Linien in dem Schneedämmer verliert und der Sturm, der ihre Rufe achtlos verschlingt.
Da wird wieder das traurige, volle Bewußtsein ihrer Lage in ihnen wach. In neuer, furchtbarer Gestalt greift der Tod wieder nach ihnen, die hilflos beisammenstehen in ihrer Wehrlosigkeit gegen die unbekämpfbaren, unversiegbaren Kräfte der Natur, gegen die unabwendbare Waffe des Frostes.
Immer wieder posaunt der Sturm ihnen das Wort ins Ohr: Hier mußt du sterben –, sterben –
Und die Todesfurcht wird in ihnen zu resignierter hoffnungsloser Ergebenheit.
Keiner hat es laut ausgesprochen, allen kam der Gedanke zugleich. Sie klettern unbeholfen, wie es die steifen Glieder gestatten, in die Wagen hinein, eng aneinander, um zu sterben.
Auf Hilfe hoffen sie nicht mehr.
Sie schmiegen sich zusammen, jeder zu seinen Liebsten, um im Tode beisammen zu sein. Draußen singt der Sturm, ihr ewiger Begleiter, ein Sterbelied, und die Flocken bauen um die Wagen einen großen, schimmernden Sarg.
Und langsam kommt der Tod. Durch alle Ecken und Poren fließt die eisige, stechende Kälte herein, wie ein Gift, das behutsam, seines Erfolges sicher, Glied auf Glied ergreift ....
Langsam rinnen die Minuten, als wollten sie dem Tode Zeit geben, sein großes Werk der Erlösung zu vollführen .…
Schwere, lange Stunden ziehen vorbei, deren jede verzagte Seelen in die Ewigkeit trägt.
Der Sturm singt fröhlich und lacht in wildem Hohn über dieses Drama der Alltäglichkeit. Und achtlos streut der Mond sein Silber über Leben und Tod.
Im letzten Wagen ist tiefe Stille. Einige sind schon tot, andere in dem halluzinatorischen Bann, mit dem das Erfrieren den Tod verschönt. Aber alle sind sie still und leblos, nur die Gedanken schießen noch wie heiße Blitze wirr durcheinander ....
Josua hält seine Braut mit kalten Fingern umspannt. Sie ist schon tot, aber er weiß es nicht .…
Er träumt .......
Er sitzt mit ihr in dem duftdurchwärmten Gemach; der goldene Leuchter flammt mit seinen sieben Kerzen, und alle sitzen sie wieder beisammen wie einstmals. Der Abglanz des Freudenfestes ruht auf den lächelnden Gesichtern, die freundliche Worte und Gebete sprechen. Und längst gestorbene Personen kommen zur großen Türe herein, auch seine toten Eltern, aber es wundert ihn nicht mehr. Und sie küssen sich zärtlich und sprechen vertraute Worte. Und immer mehr nahen, Juden in altväterlichen, verblichenen Trachten und Gewändern, und es kommen die Helden, Juda Makkabi und alle die anderen; sie setzen sich zu ihnen und sprechen und sind fröhlich. Und immer mehr nahen. Das Zimmer ist voll von Gestalten, seine Augen werden müde vom Wechsel der Personen, die immer rascher wandeln und durcheinanderjagen, sein Ohr dröhnt von dem Wirren der Geräusche. Es hämmert und dröhnt in seinen Pulsen, heißer, immer heißer –
Und plötzlich ist alles still, vorbei ....
Nun ist die Sonne aufgegangen und die Schneeflocken, die noch immer niederhasten, schimmern wie Diamanten. Und wie von Edelsteinen schimmert es auf dem breiten Hügel, der über und über mit Schnee bedeckt, sich über Nacht aus der Ebene erhoben hat.
Es ist eine frohe, starke Sonne, beinahe eine Lenzsonne, die plötzlich zu leuchten begonnen hat. Und wirklich ist auch der Frühling nicht mehr fern. Bald wird er alles wieder knospen und grünen lassen und wird das weiße Linnen nehmen von dem Grabe der armen, verirrten, erfrorenen Juden, die in ihrem Leben einen Frühling nie gekannt …
....
DAS KREUZ
Es war im Kriegsjahre 1810. Eine ungeheure brandige Staubwolke wälzte sich auf der Heerstraße Katalaniens Hostalrich zu, das die Spanier so hitzig verteidigten und die Franzosen so rastlos bestürmten. Manchmal schlug ein lässiger Windstoß den weißen Schleier auseinander, aus dem schattenhaft schwerfällige Wagen, in lose Gruppen gereihte Soldaten, matt vorwärtsschleifende Pferde auftauchten, ein Provianttransport, den ein erfahrener Colonel mit seiner Truppe schützte. Geschlängelt und schräg kroch der weiße Weg aus dem lehmigen Land der Hügelwellen empor und strebte einem kleinen Walde zu, der violett flammte, rot umkantet von der niedersinkenden Abendsonne. Schon rollte die Staubwolke gemächlich ins Baumdunkel, das schweigsam den knarrenden Zug erwartete.
Plötzlich wie eine Rakete ein Schuß aus dem Dunkel. Ein Zeichen offenbar. In der nächsten Sekunde prasselte ein mörderisches Schnellfeuer auf den eingekeilten Zug. Rechts und links fielen Soldaten, ehe ihnen Zeit blieb, die Flinte zu fassen, aufwiehernd stürmten die erschreckten Pferde empor, so daß die Wagen überschlugen oder mit dumpfem Stoß ineinanderrannten. Mit einem Blick übersah der Colonel die Situation; Widerstand war Wahnsinn, Flucht gefährlich.
Wie eine Trompete überschrie sein Ruf den Lärm. Er befahl den Angriff gegen eine Flanke, den Transport und die Verwundeten dem Feindüberlassend. Fanatisch knatterte die Trommel unter den fiebernden Händen des kleinen Tambours, und ohne Ordnung, ungestüm und unwiderstehlich, sprangen die Franzosen gegen die linke Seite der Straße in den Wald, dessen Bäume sich seltsam zu beleben begannen. Blitze rannen herab von den Kronen, die schwankten von ungewohnter Last, dunkle Gestalten streiften wie schwarze Schlangen die Äste hinab, und manchmal fiel dumpf, wie eine riesige Frucht, menschliche Masse von den zornig nachschwingenden Zweigen. Spanier, die im Buschwerk kauerten, flüchteten zurück vor den blind ins Dunkel stechenden Bajonetten der Franzosen, die verzweifelt vorwärtsfegten, um die Lichtung der Höhe zu gewinnen. Dazwischen brandete dumpf das Getöse von Schuß und Schrei, verrauschend in schreckhaftem Echo. Allen voran, Pistole und Säbel in der Hand, stürmte der Colonel. Plötzlich griff sein Arm steil in die Luft mit gekrampfter Hand. Sein Fuß hatte sich in einer Wurzel gefangen, und nun, wie er hinschlug, schmetterte sein Kopf so heftig gegen einen Baum, daß er mit leerem Blick ins Dunkel eines Busches fiel, dessen Genen heftig über ihm zusammensausten. Achtlos hetzte an dem Ohnmächtigen der Kampf vorbei. -
Als der Colonel die Augen wieder aufschlug, lag er einsam in Dunkel und Stille. Über ihm schaukelten die Äste in den abendlich verschalteten Himmel, die Luft mit dumpfem Sausen erfiillend. Wie er den Kopf heben wollte, fühlte er Blut auf den Lippen. Unsicher denkend tastete er den Striemen nach, welche die Gerten im Niederschnellen über sein Gesicht gezogen. Und rasch belebte sich nun das Erinnern. Von der Stelle des Überfalles trug der Wind undeutlich das wirre Geräusch angeschirrter Pferde und fortrollender Räder her, ferner und immer ferner. Offenbar entführte die siegreiche Guerillabande ihre Beute. In das erste Erinnern mischte sich schon dumpfer Schmerz: der Colonel fühlte, daß die Entscheidung gänzlich aus seinen Händen geglitten sei und nur mehr im Spiel des Zufalls schwanke. Einsam war er in einem fremden Walde, einsam in Feindesland. Ein Blitzen seines Säbels, ein Knacken im Unterholz konnte ihn ausliefern, eine wehrlose Beute für die Torturen der Aufständischen. Denn seitdem Augereau die Wege mit Schnellgalgen gemessen, seit ohne Gericht die Spanier zusammengeschossen wurden, fanden die Franzosen schreckhafte Spuren der Rache in den verlassenen Dörfern, die verkohlten Leichen der von langsamem Feuer verbrannten Soldaten, die faulenden Leichen der gepfählten Gefangenen, furchtbare Bilder überstandener Qualen und tierischer Grausamkeit. Das alles blitzte auf in seinem Gehirn, so rasch, so grell, daß er zusammenfuhr, wie von Fieber geschüttelt.. Dunkler und dunkler rauschte um ihn der Walddes Unheils, der ihn gefangen.
Der Colonel überlegte, alles ungestüme Entscheiden erdrosselnd. Nur Flucht war möglich, nächtliche Flucht aus dem Gehölz, Flucht entweder Hostalrich zu oder die Straße zurück, bis er wieder französischen Truppen begegnete. Aber Flucht um jeden Preis, das fühlte er, so sehr ihm auch der Gedanke seiner kläglichen Wehrlosigkeit das Herz verbrannte. Noch verdammte ihn das fahle Licht, das über den Wipfeln hing, zur Untätigkeit. Mit verbissenen Lippen und brennenden Augen, reglos unter dem Busche liegend, mußte er noch warten, warten auf die runde Mondscheibe, die grünlich glimmernd aus den Abendnebeln zur Himmelshöhe schwamm, mußte horchen aufjecle Erschütterung des Bodens, jede hinzitternde Regung der Luft, jeden Vogelschrei aus der Tiefe des Waldes, jedes Stöhnen in den abendwindgeschaukelten Ästen. Erinnerung an die endlosen Nächte Ägyptens erfüllte ihn mit Grauen, an jene schweflig gelben Nachthimmel, angefüllt mit grenzenlosem Schweigen und unnennbarer Drohung. Die ganze Schwere rettungslosen Verlassenseins hing sich an sein Herz.
Nach Stunden und Stunden endlich, als das Gehölz wie vereist stand im kalten Mondlicht, kroch er vorsichtig auf den Knien gegen die Stelle des Überfalls zurück, zitternd nicht so sehr von Angst wie von fiebriger Glut unbestimmter Erwartung. Mit einer unendlichen Behutsamkeit, die seiner Erregung furchtbarste Qual war, tastete er auf allen vieren nach vorne durch das Buschwerk der verfilzten Sträuche und das harte Netz der Baumwurzeln. Eine Ewigkeit wurde ihm der Weg von Baum zu Baum. Endlich glänzte, hell wie ein Teich, die Landstraße durch das schläfrige Dunkel der Umsäumung.
Aufatmend reckte er sich empor, um nun auf dem verlassenen Wege zurückzueilen, die Pistole in der Hand und den Säbel in steter Bereitschaft. Da-er fuhr zusammen-glitt ein
Schatten hart vor ihn hin. Und lief wieder zurück Und wieder her und hin, ganz undeutlich und doch fühlbar wie ein kalter Hauch.
Der Colonel packte die Pistole und starrte ins Dunkel der Bäume. Aber kein Laut zuckte auf. Und doch: langsam und stetig kroch wieder der Schaden in den Kies der Straße, und unruhig, unwesenhaft dunkelte er wieder verlöschend zurück. Ging und kam wie ein Pendelschlag, geheimnisvoll und lautlos, ein Gespenst der Nacht. Atemlos folgte der Colonel seinem Wege. Und schauerte jählings zusammen, als er die Augen emporwandte gegen das Mondlicht.
Knapp zu seinen Häupter, an dem vorgeneigten Zweige einer jungen Korkeiche pendelte eine nackte Leiche, bleich und grauenhaft schimmernd in der kreidigen Mondgrelle. Pendelte in ruhigem Gang wie der Schatten über die Straße. Und wie der erschreckte Blick weitergriff von Baum zu Baum, vervielfältigte sich das schaurige Bild. Tote, hoch aufgeknüpft in den Schatten der Baumkronen und nur fahl vom gespenstischen Zwielicht übergossen, schienen mit phantastischen Gesten zu winken, die bleichen Körper unruhig im Winde hin und her werfend. Röchelnd quoll der Atem aus der Kehle des Colonels, als er über den verzerrten Gesichtern die höhnisch aufgepflanzten Bärenmützen seiner Soldaten sah Seine Soldaten, tapfere, brave Kerle, mit denen er noch gestern beim Wachtfeuer gescherzt, von Briganten, von Räubern, von Spaniern hingehängt wie gerupfte, erwürgte Hühner, zuerst gemeuchelt, dann gemartert, geschmäht, bespien! Taumelnd vor Wut sprang er auf, hämmerte im wahnwitzigen Bedürfnis, etwas zu tun, mit der Faust gegen die harten Bäume. Und warf sich wieder hin mit verbissen. Zähnen, Wurzeln ausreißend und zerlmirschend, fiebernd in der Qual seiner Wehrlosigkeit, aufglühend im Verlangen, etwas zu tun, zu brüllen, zu schlagen, zu drosseln, zu morden. Ein Übermaß war in ihm vom qualvollen Drängen, eine hochgepeitschte Flamme der Wut und Verzweiflung. Und immer wieder die Schatten über der Straße und das dumpfe Sausen des Waldes! Seit Jahren und Jahren fühlte der Colonel zum erstenmal ein Brennen in den Augen wie von Tränen, zum erstenmal fuhr Napoleons Name mit einem Fluch von seinen Lippen, daß er ihn in dieses Land der Mörder und Leichenschänder gesandt habe. Und dieser verwühlte sich diese fassungslose, fiebernde Wut. Wie Feuer quoll es in seinen Händen.
Da plötzlich ein Geräusch! Ein Schritt ... Blut und Atem, Fieber und Zorn, Denken und Besinnung stürzten in eine Sekunde der Erwartung. Tatsächlich: ein Schritt, ein heraneilender Schritt. Und schon ein Schatten zwischen den Bäumen dort, wo sich die Straße in den Wald bog. Instinktiv kauerte sich der Wartende ins Dunkel hinein, die Waffen gierig umkrampfend, dumpf und jubelnd keuchte seine Brust, als er im flüchtigen Mondschimmer einen Spanier erkannte. Ein Bote vielleicht, ein Hirte, ein Marodeur, ein Versprengter, ein Bauer, ein Bettler nur möglicherweise,- aber - es glühte und zuckte in seinen Händen: ein Spanier, ein Mörder, ein Schurke. Wut und Wille fieberten zusammen in ein Ziel. Einen Schritt ließ er, der Lauernde, dem eilenden Spanier
voraus, dann warf er sich mit einem dumpfen Schrei der Wut auf den Erschreckten, umklammerte mit der Linken im Krampf seine Kehle, den Schrei des Entsetzens mit den Engem erwürgend. Und dann-eine Sekunde wollüstig ruhend im Anblick der im Todeskampf verquollenen Augen -tauchte er sein Messer in den Rücken des Opfers, langsam zuerst, grausam und überlegt genießend. Und stieß es ihm dann in aufzuckendem Zorn wieder und wieder, rascher und rascher durch Rücken und Kehle, heftiger und heftiger, daß endlich die Klinge, am Wirbel abgleitend, ihm in die eigene Hand fuhr. Der Schmerz und das Rieseln des warmen Blutes brachten den Rasenden wieder zur Besinnung. Wie mit Ekel schüttelte er die Leiche von sich, daß sie kreiselnd gegen den Graben taumelte und dumpf klatschend hinschlug.
Mit einem einzigen tiefen Atemzuge sog er dann die kühle Nachtluft ein. Es war ihm wunderbar frei geworden. Nicht Zorn, Angst, Bangen, Reue, Glut fühlte er mehr, nur kühle, kühle, die mondkühle, volle, von sanftem Wind geschwellte Luft, die über seine Lippen rann. Kraft, Mut und eiliges Besinnen Einte wieder seine Glieder hochgereckt, empfand er sich wieder als Colonel Napoleons. Ruhig und sicher stieg das Denken vom Vergangenen mm Zukünftigen. Der Leichnam des voreilig und in blindem Zorn Getöteten mußte ihn verraten: das übersah er klar. Wie er sich über das verzerrte Gesicht hinbeugte, das im unsicheren Mondlicht beinahe bewegt erschien von gespenstischem Leben, starrten ihn die gläsernen Augen mit unheimlichem Ausdruck an. Aber nicht Furcht und nicht Reue überkam den Colonel, nicht einmal der springende Schauer momentanen Grauens. Furchtlos faßte er die Leiche, schleifte sie durch die unwillig lmickenden Büsche dem Versteck zu, das ihn selbst beschützt hatte, und warf den schweren Körper lässig ins Gehölz. Er atmete auf. Keine Erregung walke mehr durch seinen Körper, aber dumpf begann ihn die Müdigkeit zu drücken, die Abspannung der vielen furchtbaren Stunden. Der Morgen konnte nicht mehr ferne sein, denn schon hing blasser das Mondlicht im Gesträuch So gab er den Fluchtplan als verspätet auf. Und ohne neuen Möglichkeiten nachzusinnen, warf er sich, nur seiner Müdigkeit gehorchend, zu Boden hin, zwei Schritte kaum von dem Toten gelagert. Und schlief schwer und bleiern, wie auf den Schlachtfeldern Italiens und Österreichs in der Einsamkeit des Todes.
Im gelben Lichte eines verwölkten Morgens aus dieser Nacht des Schreckens erwachend, überlegte der Colonel, zitternd im Frühfrost und würgend an dem bitteren Druck seiner Kehle, die verzweifelte Lage. Kenntlich als Soldat, unkund der Sprache, durfte er nicht einen Schritt aus diesem Walde wagen, der ihn fmster umrauschte. Er mußte wieder warten, untätig warten bis zum Abend, mußte hoffen auf vorüberstreifende französische Truppen, auf ein Unerhörtes, Unwahrscheinliches. Langsam, wie ein nagendes Tier, fraß sich eine andere Stimme aus ihm empor, unruhig und quälend: der Hunger zerfetzte seine Eingeweide. Und Durst brannte auf seinen Lippen. Ein furchtbarer Tag der Qualen brach an; Gedanken, ätzend wie die erdige Feuchtigkeit, die er aus emporgerissenen Wurzeln sog, zerfurchten sein Gehirn. Unruhig spielte
er mit der geladenen Pistole, die alles enden konnte. Nur der Schmerz, der Stolz zu verrecken wie ein Tier in einem Walde, nutzlos, ohne Kampf, fern von seinen Truppen, hielt die Finger vom Drücker. In dumpfer Qual blieb er hingestreckt, Stunden und Stunden, die Ewigkeit vom Morgen bis zum Abend. Ringsum ging das Leben in höhnischem Gleichtakt von der Straße her löschte manchmal das flüchtige Geräusch von Vorüberziehenden für einen Augenblick die entsetzliche Einsamkeit aus, dann aber kamen wieder Stunden, nur erfüllt vom Sausen des Windes und dem Ächzen der Äste. Niemand nahte, die Gitterstäbe des unsichtbaren Gefängnisses zu lösen; wie ein Verwundeter im Feld, der in den leeren Himmel stöhnt, blieb er liegen, liegen mit matten Händen und fiebemder Stirne in dem Walde, der feucht in der steigenden Sonne schwelte.
Endlich nach Stunden wahnsinniger Qual schrägten die Sonnenstrahlen. Der Abend kam, und mit ihm ein verzweifelter Entschluß. Mit jähem Ruck riß sich der Colonel die Kleider vom Leib und warf sie hin ins Dunkel. Tastete dann in das Blättergewirre, wo die Leiche des gemordeten Spaniers auf dem Antlitz lag, scharrte sie empor und nahm, Stück für Stück, seine Bekleidung, zerrte die blutige Mantilla aus der gekrampften Todeshand. Und hüllte sich ohne Grauen, gejagt von seinem letzten, unbeugsamen Entschluß in die spanische Tracht, den Mantel über den Rücken sich schlagend, wo die breite, noch feuchte Blutspur das Gewand überfloß. So wollte er fliehen, wollte er sich Brot erbetteln; die würgende Glut stillen, die seinen Körper zerriß, wollte sich reden aus
diesem Netz des Grauens, diesem Walde des Todes. Wollte hin zu Menschen, nicht mehr wie ein Tier zwischen Leichen leben, gehetzt von Furcht und Hunger, wollte wieder zurück zu seinem Heer, zu seinem Kaiser, sei es auch um den Preis seiner Ehre. Ein Schluchzen hing ihm in der Kehle, als er seine Uniform wie eine Leiche verlassen sah, die Uniform, die er durch zwanzig Schlachten getragen, die mit seinem Sein verwachsen war wie die Mutter mit dem Kinde. Aber der Hunger stieß ihn fort, der Straße, der Dämmerung zu. Wie er sich rückwärts wandte, zum letztenmal, zum Abschied, fühlte er durch den Glanz der Tränen ein Schimmern wie das eines Auges. Es war das Kreuz, das Napoleon ihm selbst auf dem Schlachtfelde angeheftet. Das konnte er nicht lassen. Mit dem blutigen Dolch schnitt er es ab und barg es in der Tasche. Und ging, stieß sich nach vorwärts, eilte, hetzte der Straße zu.
Kaum eine Meile weit von dem Gehölz, das wußte er, war ein kleines, wüstes Dorf. Die Kompagnie hatte dort gerastet, und unsicher entsann er sich - zerquält von der zerrenden Gier des Hungers und dem Hämmern des Blutes - eines runden Brunnens am Platze, wo sie die Pferde getränkt hatten. Auch die finstern Gesichter der Spanier tauchten auf in seiner Erinnerung, dieser mühsam verhaltene Hohn der Verräter, aber alles, alles verlosch in dem einzigen Gefühl: Hunger! Und so eilte er fast taumelnd die schondunkle Landstraße hinab, das Gesicht tief mit dem Hure verschaffend, eilte und eilte, um im Lauf das Aufquellen des Hungers zu überrasen, eilte so keuchend, hie er endlich das Dunkel sich formen sah, bis Häuser, verschachtelt und enge, herauswuchsen aus dem sinkenden Abendgewölk. Er tappte dem Platze zu und ließ zuerst das sprudelnde Wasser in seine Gurgel rinnen, tauchte Hände und die fiebrige Stirn gierig in die Kühle. Ein erster Augenblick des Wohlgefühls durchrieselte ihn seit endlosen Stunden. Aber in der nächsten Stunde fühlte er wieder die Faust des Hungers aus seinem Leibe sich recken, die ihn vorwärts stieß, der ersten Türe zu. Unruhig klopfte er gegen die morsche Pforte. Ein altes Weib, das gelbe Gesicht von Runzeln zerschnitt., sah ihn mit bösen, mißtrauischen Augen an, den Spalt nur halb auftuend. Er deutete mit der Geste der Stummen auf die Lippen und machte eine flehende Gebärde. Sein Soldatenherz war tot in dieser Sekunde, begraben im Walde obn mit seinem Säbel und seinem Kleid. Das Weib wandte sich verneinend ab und wollte die Türe schließen. Aber der Hungernde, wie betäubt von dem öligen Geruch der Speisen, vom brenzligen Dunste, der dem Hause entströmte, faßte, allen Stolz vergessend, ein Tier nur mehr in seinem rasenden Verlangen, den Arm der entsetzt Zurückweichenden, um sie zu beschwören. Die Flamme des Wahnsinns zuckte grell in seinen Augen. Da warf sie, statt aller Antwort, die wuchtige Tür gegen die Stirn des Vordringenden, daß er betäubt zurücktaumelte. Ein wilder französischer Fluch fuhr ihm aus der Kehle; erschreckt sah sich der Colonel um. Gottlob, niemand hatte ihn gehört, noch konnte er weiter als Taubstummer betteln. Und er tat es, tat es mit brennendem Herzen, ging von Haus zu Haus, bis er endlich ein paar Kulmen gelbkörnigen Brotes und fünf, sechs feuchte Oliven in der Hand hielt. Mit gierigen Stößen würgte er alles hinab, Hunger, Ekel, Scham mitschlingend, fraß wie ein Tier mit stumpfem Blick und verzerrten Mienen. Ehe er an dem letzten, schwarzen Schuppen des Dorfes vorbei war, hatte er leere Hände.
Eine furchtbare Frage stieg wieder auf mit den rings aufwallenden Schatten der Nacht. Wohin nun? Er hatte fliehen wollen, den Weg zurück, den die Kolonne gekommen. Aber mm hing ihm Blei an den Füßen. Und alle Spannkraft war zerschnitten. Seit er fremdes Kleid trug und bettelnd von Haus zu Haus gegangen, war Mut und Verwegenheit zerronnen, aller Wille zum Leben matt und treibend geworden. Dumpfe Schläfrigkeit erfüllte sein ganzes Sein. Und ohne es zu wissen, schleifte er sich mechanisch wieder zu dem Walde hin, der ihn gefangen, der ihn zuhalten und zulocken schien mit einer geheimnisvollen Kraft. Die Straße, die er einmal mit seinen Soldaten gegangen, heiter und sorglos, führte ihn wieder zurück in den Wald, wo sie der Tod belauert hatte, wo er noch hing zwischen den schwarzen Zweigen, gespenstig rauschend. Aber es trieb ihn hin wie im Traum. Das Bedürfnis zu ruhen, zu ruhen, ganz auszulöschen in der Mattigkeit des Ruhens zog ihn unwiderstehlich in das Baumdunkel. Er klomm die Böschung mit müder Anstrengung empor und ließ sich ohne Gedanken, ohne Fühlers in das Dunkel fallen, knapp am Straßenrande. Weiter wagte er sich nicht, um den Blick seiner toten Gefährten zu meiden, um nicht sein Soldatenkleid mehr zu sehen, das, ein blutiger Fetzen, höhnisch im Dunkel lag, um nicht die Ahnung des Todes in diesen Zeichen zu erkennen. Gläubig wie ein Priester umpreßte er das Ehrenkreuz in der Tasche. Das war sein jubel, seine Klage, seine Hoffnung.
Und wieder begann eine Nacht, die zweite, furchtbare Nacht, eine Mondnacht mit vielen kalten Sternen, mit der Trostlosigkeit eines klar gewölbten, unendlich stillen Firmamentes, von dem schwere Einsamkeit herniedersank. Der Colonel starrte mit seinen tränenlosen, verbrannten, wahnwitzigen Augen auf den Weg, der weiß in das sinnlose Dunkel lief. Was sollte auf diesem Wege kommen? Hoffnung, Befreiung, Freunde? Eine Diligencia vielleicht, die ihn aufnahm, französische Truppen? Aber all diese Gedanken rannen wirr in die große Müdigkeit zusammen, versponnen mit dem dunklen Sausen der Blätter, dem zitternden Fernglanz der Sterne und den gleitend. Mondstrahlen. Wie in einem Grab ruhte er in diesem einsamen Walde. -
Am frühen Morgen gellte ein Ruf den Colonel aus dem Schlafe. Ein Vogelruf, wie er meinte, traumtaumelnd aufstarrend in das Nebelnetz des Morgens. Aber jetzt wieder-war es nicht unseliger Traum? - nein, ganz scharf, ganz deutlich, ein Hornsignal, Trompetensignal naher Truppen
In jähem Sterze hielt sein Blut an. Sollten das wirklich Franzosen sein, Freunde, Retter? Sollte er doch noch zurück ins Leben? Unsäglicher wahnsinniger Jubel quoll bis in seine Kehle. Er sprang auf- und da, von der Straße her sah er sie kommen, Truppen französische Soldaten in losen Reihen, sah die Mützen, die Säbel, die Fahnen, die Geschütze. Ein Hilfekorps für Hostalrich off.bar.
Da brach er los, der Jubel zerspreng. sein Besinnen. Sein Schicksal, die Gefahr, die Verldeidung vergessend, hinstolpemd in wahnsinniger Überheizung, sauste er den Befreiern entgegen, die Mantilla zum Gruße wirbelnd und mit der andern Hand die Pistole. Und ein Schrei, ein tierischer Schrei, in dem Angst, Qual und Verzweiflung kreischten, ein Schrei, in dem übermenschlicher Jubel in die Lüfte stieß, fuhr auf in den Morgen.
Als er so zur Lichtung stürmte, geschah das Unvermeidliche. Zwei, vier, zehn Schüsse-eine ganze Salve -1marterte dem vermeintlichen Spanier entgegen, der-noch vorwärtstaumelnd im hitzigen Lauf - zögerte, schwankte und blutüberströmt hinschlug. Rasch formte sich das Bataillon. Man erwartete einen Überfall, Signale gellten, die Trommel rasselte. Und dann eherne Stille. Alles war gerüstet, harrte, wartete mit verhaltenem Atem. Aber kein Feind zeigte sich, auch die vorgesandt. Tirailleure meldeten nichts. Da löste sich wieder die Ordnung. Ohne weiter den Irrtum zu bedenken - es war ja nur ein Spanier- schulterten die Soldaten ihre Gewehre, und der Marsch ging vorwärts ins Gehölz, Hostalrieh zu.
Nur ein paar Soldaten traten aus der Reihe, um die Leiche zu plündern. Ohne das leise Röcheln des Sterbenden zu beachten, rissen sie an den Kleidern und wühlten in den Taschen. Und eine grenzenlose Wut überkam sie, als einer in den blutigen Fetzen das Ordenskreuz des vermißten Colonels fand. Ein Kreuz Napoleons in der Tasche eines spanischen Banditen! Mit erbitterten Kolbenstößen schmetterten sie dem vermeintlichen Mörder das Gehirn ein, hämmerten in blindem Zorn auf den entblößten Körper und traten ihn fluchend mit Füßen; dann schleuderten sie den Leichnam des Unglücklichen mit so heftigem Schwung ins Feld, daß er - die Luft schreckhaft mit seinen Armen durchwühlend - gespreitet hinfiel, als ungeheures, helles Kreuz, aufleuchtend in den schwarzen, verbrannten Ackerschollen.
DIE HOCHZEIT VON LYON
Am zwölften November 1793 brachte Barrere im französischen Nationalkonvent gegen das abtrünnige und endlich erstürmte Lyon jenen tödlichen Antrag ein, der mit den lapidaren Worten endigte: »Lyon bekämpfte die Freiheit, Lyon ist nicht mehr.« Die Gebäude der volksaufrührerischen Stadt sollten, so forderte er, dem Erdboden gleichgemacht, seine Monumente in Asche verwandelt und selbst der Name ihr genommen werden. Acht Tage zögerte der Konvent, so völliger Vernichtung der zweitgrößten Stadt Frankreichs zuzustimmen, und selbst nach der Unterzeichnung führte der Volksbeauftragte Couthon, des geheimen Einverständnisses Robespierres gewiß, jenen herostratischen Befehl nur lässig aus. Um der Form zu genügen, versammelte er mit großem Pomp das Volk auf dem Platz von Bellecourt und klopfte mit silbernem Hammer symbolisch gegen die der Vernichtung bestimmten Häuser, aber nur zögernd brach dann der Spaten in die herrlichen Fassaden ein, und die Guillotine übte noch sparsam ihren dumpf dröhnenden Niederfall. Von dieser unerwarteten Milde beruhigt, begann die vom Bürgerkrieg und monatelanger Belagerung grausam erregte Stadt schon wieder ersten Atem der Hoffnung zu wagen, als plötzlich der human zögernde Tribun abberufen wurde und statt seiner Collot d’Herbois und Fouche in Ville Affranchie — denn so hieß von nun ab Lyon in den Dekreten der Republik — mit der Schärpe der Volksbeauftragten geschmückt erschienen. Nun wurde über Nacht, was bloß als pathetisch abschreckendes Dekret vermeint war, grimmige Wirklichkeit. »Man hat hier bisher nichts getan«, meldete ungeduldig, die eigene patriotische Energie zu erweisen -und den milderen Vorgänger zu verdächtigen, der erste Bericht der neuen Tribunen an den Konvent, und sofort setzten jene furchtbaren Exekutionen ein, an die sich Fouch8, der »mitrailleur de Lyon«, als späterer Herzog von Otranto und Verteidiger aller legitimen Prinzipien nur ungern mehr erinnern ließ.
Statt des langsam aufmörtelnden Spatens sprengten jetzt Pulverminen reihenweise die herrlichsten Gebäude nieder, statt der »unzuverlässigen und unzulänglichen« Guillotine erledigten Massenfusilladen und Kartätschen Hunderte von Verurteilten mit einer Salve. Geschärft durch täglich neue und schneidende Dekrete mähte die Justiz weitausholend wie eine Sense Tag um Tag ihre riesige Menschengarbe, längst schon besorgte die rasch wegschwemmende Rhöne das zu langsame Geschäft des Einsargens und Gräbergrabens, längst genügten die Gefängnisse nicht mehr für die Fülle der Verdächtigten. So wurden die Keller der öffentlichen Gebäude, Schulen und Klöster den Verurteilten zum Aufenthalt bestimmt, freilich zu flüchtigem bloß, denn die Sense hieb rasch zu, und selten wärmte das gleiche Stroh denselben Leib mehr als eine einzige Nacht.
Zu so tragisch verkürzter Gemeinsamkeit war an einem scharffrostigen Tage jenes blutigen Monats wieder ein Trupp Verurteilter in die Keller des Stadthauses getrieben worden. Mittags hatte man sie Mann für Mann vor die Kommissare geführt und in fliegendem Fragespiel ihr Schicksal erledigt; nun saßen die vierundsechzig Verurteilten, Frauen und Männer, wirr durcheinander in dem niedergewölbten, nach Weinfässern und Moder dünstenden Dunkel, das im Vorderraum ein kärgliches Kaminfeuer eher durchfärbte als durchwärmte. Die meisten hatten sich lethargisch auf ihre Strohsäcke hingeworfen, andere schrieben an dem einzig bewilligten Holztisch bei wackeligem Wachslicht hastige Abschiedsbriefe, wußten sie doch, daß ihr Leben eher zu Ende sein würde als die im kalten Raume blauschauernde Kerze. Keiner von ihnen aber sprach anders als flüsternd, und so dröhnte deutlich in die gefrorene Stille von der Straße her die dumpfe Explosion der Minen und das rasch ihr folgende Niederkrachen der Häuser. Doch schon war durch die schmetternde Geschwindigkeit der Geschehnisse alle Fähigkeit des Gefühls und cdes deutlichen Denkens den Geprüften genommen; reglos und wortlos lehnten die meisten im Dunkel wie in einem Vortraum ihres Grabes, nichts mehr erwartend und mit keiner Regung mehr dem Lebendigen zugewandt.
Da dröhnte gegen die siebte Aben&tunde plötzlich ein energisch-harter Schritt an der Türe, Kolben klirrten, der rostige Riegel kreischte zurück. Unwillkürlich schreckten alle auf: sollte gegen die triste Gewohnheit einer sonst verstatteten Nacht schon jetzt ihre Stunde gekommen sein? Im kalten Luftzug der aufgerissenen Tür sprang die Flamme blau von der Kerze, als wollte sie dem wächsernen Leib entfliehen, und mit ihr aufzuckend warf Angst sich dem Unbekannten entgegen. Aber bald beruhigte sich der jäh aufgerissene Schrecken, brachte der Kerkermeister doch nichts als einen neuen nachträglichen Schub Verurteilter, etwa zwanzig an der Zahl, die er wortlos und ohne ihnen im überfüllten Raum besonderen Platz anzuweisen, die Treppe herabführte. Dann stöhnte die schwereiserne Tür wieder zu.
Unfreundlich blickten die Gefangenen den Ankömmlingen entgegen, denn dies Seltsame ist ja der menschlichen Natur zu eigen, überall eilig sich einzupassen und selbst im Flüchtigen sich zu Hause zu fühlen wie in seinem Recht. So betrachteten die früher Gekommenen den dumpfen modrigen Raum, den schimmeligen Strohsack, den Platz um das Feuer unwillkürlich schon als ihr Eigentum, und jeder der Neueingelangten erschien ihnen ein unberufener und schmälernder Eindringling. Die eben Eingelieferten wiederum mochten jene kalte Feindseligkeit ihrer Vorgänger, so unsinnig sie auch in tödlicher Stunde war, deutlich empfunden haben, denn - sonderbar - sie wechselten mit den Schicksalsgenossen weder Gruß noch Wort, forderten nicht Teil an Tisch und Stroh, sondern drückten sich nur wortlos und mürrisch in eine Ecke. Und war vordem die Stille schon grausam über dem Gewölbe gelegen, so mutete sie nun noch finsterer an durch diese Gespanntheit eines sinnlos herausgeforderten Gefühls.
Um so klingender, heller und gleichsam wie von anderer Welt hereingeschlagen fuhr nun plötzlich ein Schrei diese Stille durch, ein heller, beinahe zuckender Schrei, der unwiderstehlich selbst den Teilnahmslosesten aus Ruhe und Gedrücktheit riß. Ein Mädchen, neu angekommen mit den anderen, plötzlich und ruckhaft war sie aufgesprungen, und sie war es auch, die sich, die Arme wie eine Stürzende vorgebreitet, mit dem zuckenden Ruf »Robert, Robert« einem jungen Menschen entgegenwarf, der abseits von den andern an dem Fenstergitter gelehnt hatte und nun seinerseits ihr entgegenfuhr. Und schon loderten wie zwei Flammen eines Feuers diese beiden jungen Gestalten Körper an Körper, Mund an Mund sich entgegen, so innig zusammenbrennend, daß die jäh ausströmenden Tränen der Entzückung eine des anderen Wangen überströmten und ihr Schluchzen wie aus einer einzigen berstenden Kehle drang. Wenn sie sich ließen für einen Augenblick, ungläubig, sich wirklich zu fühlen und vom Übermaß des Unwahrscheinlichen erschreckt, so schlug im nächsten Augenblick schon wieder neue Umfangung sie womöglich noch glühender zusammen. Sie weinten und schluchzten und sprachen und schrien in einem Atem, ganz mit sich allein im Unendlichen des Gefühls und vollkommen achtlos der Mitgefährten, die erstaunt und durch dieses Staunen belebt sich ungewiß den beiden näherten.
Das junge Mädchen war mit Robert de L ..., dem Sohn eines hohen Magistratsbeamten, seit Kindheit erst befreundet, seit Monaten dann verlobt gewesen. Schon war in der Kirche ihr Aufgebot erfolgt, und gerade jener blutige Tag, da die Truppen des Konvents in die Stadt einbrachen, ihrer Vermählung bestimmt, da gebot es die Pflicht ihrem Verlobten, der in der,,Armee Percys gegen die Republik gekämpft hatte, den Royalisten-General bei seinem verzweifelten Durchbruch zu begleiten. Wochenlang blieb dann jede Nachricht von ihm aus, und schon wagte sie zu hoffen, er habe sich glücklich über die Schweizer Grenze gerettet, als plötzlich ein Stadtschreiber ihr meldete, Angeber hätten sein Versteck auf dem Gehöft ausgekundschaftet, und gestern sei er dem Revolutionstribunal überliefert worden. Kaum hatte das kühne Mädchen von der Gefangennahme und zweifellosen Verurteilung ihres Verlobten erfahren, als sie mit jener magisch unbegreiflichen Energie, welche die Natur Frauen in Augenblicken höchster Gefahr zuteilt, das Unmögliche durchsetzte, persönlich bis zu dem unnahbaren Volksbeauftragten vorzudringen, um dort Gnade für ihren Verlobten zu erbitten. Collot d’Herbois, dem sie zuerst sich zu Füßen warf, hatte sie herb abgewiesen, er kenne keine Gnade für Verräter. Darauf war sie zu Fouch8 geeilt, der nicht minder hart als jener, aber verschlagener in den Mitteln, sich der Rührung, die ihn beim Anblick dieses verzweifelten jungen Mädchens übermannte, dadurch erwehrte, daß er log, gern hätte er zugunsten ihres Verlobten eingegriffen, aber er sehe - und dabei warf der geübte Seelenbetrüger einen lockeren Blick durch das Lorgnon auf irgendein gleichgültiges Blatt -, daß schon heute vormittag Robert de L ... auf den Feldern von Brotteaux füsiliert worden sei. Die Täuschung des jungen Mädchens gelang dem Listigen vollkommen: sie glaubte sofort ihren Bräutigam tot. Aber statt einem wehrlosen Schmerz sich weibisch hinzugeben, riß sie, gleichgültig gegen ihr nun sinnloses Leben, die Kokarde sich aus dem Haar, trat sie mit Füßen, nannte lautschreiend, daß es durch alle offenen Türen dröhnte, Fouch8 und seine rasch herbeigeeilten Leute erbärmliche Blutsäufer, Henker und feige Verbrecher. Und noch während die Soldaten sie fesselten und aus dem Zimmer schleppten, konnte sie bereits hören, wie Fouch8 ihren Verhaftungsbefehl seinem pockennarbigen Sekretär diktierte.
Dies alles habe sie - so erzählt die Leidenschaftliche beinahe freudig den Umstehenden - aber nicht mehr als wirklich und wesenhaft empfunden, im Gegenteil, ein rauschendes Gefühl der Befriedigung hätte sie bei dem Gedanken erfaßt, rasch dem hingerichteten Bräutigam folgen zu dürfen. Bei dem Verhör habe sie auf alle Fragen gar nicht mehr Antwort gegeben, so stark hätte sie schon innen das Gefühl des nahen Endes mit Freude durchklungen, ja, sie habe nicht einmal die Augen recht erhoben, als man sie mit jenem verspäteten Trupp hier ins Gefängnis hineinstieß. Denn was hätte sie in dieser Welt noch weiter beschäftigen können, da sie ihren Geliebten tot wußte und sich selbst ihm in diesem Tode schon selig. nah. Darum habe sie sich auch vollkommen anteilslos in die Ecke gelagert, bis ihr Blick, kaum der Dunkelheit gewöhnt, von der Haltung eines jungen Mannes befremdet worden sei, der nachdenklich am Fenster lehnte, ganz sonderbar ähnlich der Art, mit der ihr Verlobter vor sich hinzublicken pflegte. Gewaltsam habe sie sich verboten, einer so sinnlos trügerischen Hoffnung nachzugeben, immerhin aber sei sie aufgestanden. Und gerade in diesem Augenblick sei jener fast gleichzeitig an den Lichtkreis der Kerze herangetreten. Sie verstehe aber nicht, fügte sie in noch nachhallender Erschütterung bei, daß sie nicht gestorben sei in jener schneidenden Sekunde des Erschreckens, denn sie habe deutlich gefühlt, daß das Herz wie ein Lebendiges ihr aus der Brust sprang, als sie plötzlich ihn, den längst Aufgegebenen, vor sich lebendig sah.
Während sie dies in fliegender Eile erzählte, ließ nicht für einen Augenblick ihre Hand jene des Geliebten. Unverwandt, gleichsam noch immer ungewiß seiner Gegenwart, drängte sie immer wieder von neuem in seine Umfangung zurück, und dieser rührende Anblick jugendlicher Innigkeit erschütterte auf wunderbare Weise ihre Schicksalsgenossen. Eben noch lethargisch, müde, gleichgültig und jeder Empfindung verschlossen, umdrängten sie nun auf einmal das so sonderbar vereinigte Paar mit leidenschaftlicher Lebhaftigkeit. Jeder vergaß über diesem außerordentlichen sein eigenes Geschick, jeder gab willig dem strömenden Bedürfnis nach, ihnen ein Wort der Teilnahme, der Zustimmung oder auch des Mitleids zu sagen, aber in einer Art rauschhaftem Stolz wehrte das feurige Mädchen jedes Bedauern ab. Nein, sie sei glücklich, restlos . glücklich, da sie nun wisse, daß sie zu gleicher Stunde mit ihrem Geliebten sterbe und keiner den andern betrauern müsse. Und nur eines mindere ihr Glück, daß sie mit noch fremdem Namen und nicht als seine angetraute Frau gemeinsam mit ihm vor Gott hintreten könne.
Sie hatte dies ausgesprochen, vollkommen arglos und absichtslos und beinahe des Gesprochenen schon vergessen, immer wieder sich der Umfangung des Geliebten hingebend; deshalb wurde sie auch nicht gewahr, daß, von diesem ihrem Wunsche tiefbewegt, unterdessen ein Kriegskamerad Roberts vorsichtig zur Seite schlich und mit einem älteren Mann leise zu flüstern begann. Jenen aber schienen die zugeflüsterten Worte sehr zu erschüttern, denn sofort raffte er sich empor und mühte sich zu den beiden hin. Er wäre, wandte er sich ihnen zu, was seine bäuerliche Kleidung wohl nicht erkennen lasse, ein eidverweigernder Priester aus Toulon und sei erst hier infolge einer Denunziation festgenommen worden. Aber wenn das priesterliche Gewand ihm jetzt fehle, so fühle er doch unverändert in sich sein Amt und seine priesterliche Macht. Und da der beiden Aufgebot längst erfolgt sei, andererseits das Urteil einen Aufschub nicht verstatte, so wolle er sich gerne unterfangen, ihr durchaus redliches Begehren sofort zu erfüllen und sie hier vor der Zeugenschaft ihrer Mitgefährten und jenes allerorts gegenwärtigen Gottes ehelich zu vereinigen.
Erstaunt von dieser nochmaligen und nie erhofften Wunscherfüllung blickte das junge Mädchen fragend ihren Verlobten an. Der antwortete mit einem strahlenden Blick. Da beugte das junge Mädchen ihre Knie auf die harten Fliesen, küßte die Hand des Priesters und bat, auch in diesem unwürdigen Raume die Vermählung zu vollziehen, denn sie fühle sich reines Sinnes und ganz von der Heiligkeit der Stunde erfüllt. Die anderen, tief erschüttert, daß dieser dumpfe Todesraum für einen Augenblick zur Kirche werden sollte, wurden unwillkürlich von der Erregung der Braut berührt und verdeckten sie mühsam durch vielfältige und hastige Tätigkeit. Die Männer reihten die wenigen Sessel heran, stellten die Wa’hslichter in gerader Reihe um ein eisernes Kruzifix und näherten so den Tisch einem Altar an, die Frauen flochten indes hastig die wenigen Blumen, die ihnen mitleidige Hände auf den Weg gegeben hatten, zu einem schmalen Kranz, den sie dem Mädchen auf das Haupt drückten, unterdessen war der Priester mit dem ihr zubestimmten Gatten in den Nebenraum getreten und hatte erst ihm und dann ihr die Beichte abgenommen, und wie die beiden nun vor den improvisierten Altar traten, entstand für einige Minuten eine so erfüllte und so auffällige Stille, daß plötzlich der Wachsoldat, irgendein Verdächtiges vermutend, die Tür aufriß und eintrat. Als er die sonderbare Vorbereitung bemerkte, wurde unwillkürlich sein dunkles Bauerngesicht ernst und ehrfürchtig. Er blieb, ohne zu stören, an der Tür stehen und ward so selber schweigsamer Zeuge der ungewöhnlichen Vermählung.
Der Priester trat vor den Tisch und erklärte in wenigen Worten, daß überall eine Kirche und ein Altar sei, wo Menschen sich in Demut Gott verbinden wollten. Dann kniete er hin und alle Anwesenden mit ihm; es blieb so still, daß keine der schmalen Flammen sich bewegte. Dann fragte der Priester in das Schweigen hinein, ob die beiden sich in Leben und Tod vereinen wollten. Mit fester Stimme antwortete sie: »In Leben und Tod«, und dieses Wort Tod — eben noch als ein Grauen gefühlt — schwang hell und klar und von keiner Furcht mehr durchzittert quer in den schweigenden Raum.
Da einte der Priester ihre Hände und sprach die bindend Worte: »Ego auctoritate sanctae matris Ecclesiae qua fungor conjungo vos in matrimoniam in nomine Patris et Filii Spiritus sancti.«
Damit war die Zeremonie beendet. Die Neuvermählten küßten dem Priester die Hand und jeder von den Verurteilten drängte einzeln zu, ein besonderes Wort der Herzlichkeit ihnen zu sagen. Niemand dachte in dieser Sekunde an den Tod, und die ihn fühlten, empfanden seine Schrecknis nicht mehr.
Unterdessen hatte jener Freund, der bei der Vermählung als Zeuge gedient, mit einigen anderen leise geflüstert, und bald merkte man neuerdings eine sonderbare Geschäftigkeit beginnen. Die Männer trugen die Strohsäcke aus dem kleinen Nebengemach, und noch hatten die Neuverbundenen, ganz dem traumhaften Geschehen hingegeben, nichts von den Vorbereitungen bemerkt, als jener zu ihnen trat und lächelnd mitteilte, gerne hätten er und seine Schicksalsgenossen dem Paare ein Geschenk zu ihrem bräutlichen Tage geboten, doch welche irdische Gabe gelte noch jenen, die ihr eigenes Leben nicht zu halten vermöchten. So wollten sie das einzige bieten, was Neuvermählten erfreulich und kostbar sein könnte: die abgesonderte Stille einer bräutlichen und letzten Nacht, und lieber selber etwas gedrängter im äußeren Raum zusammenrücken, damit jenen das kleinere Gemach vollkommen gehöre. »Nützt die wenigen Stunden«, fügte er bei, »kein Atemzug Leben wird uns nochmal zurückgegeben, und wem in solchem Augenblicke noch Liebe gegönnt ist, der soll sie genießen. «
Das junge Mädchen errötete bis tief ins Haar, ihr Gatte aber sah frank dem Freunde in die Augen und schüttelte ergriffen die brüderliche Hand. Sie sprachen kein Wort, blickten einander nur an. Und so geschah es, daß ohne eine laute Anordnung unwillkürlich die Männer sich um den Bräutigam, die Frauen um die Braut reihten und mit feierlich erhobenen Lichtern sie hineingeleiteten in das vom Tode geliehene Gelaß, unbewußt derart uralten Hochzeitsbrauch wieder erfindend aus dem Übermaß teilnehmenden Gefühls.
Leise lehnten sie die Tür dann zu hinter den Vermählten, keiner aber wagte ein unziemliches oder unsauber scherzen- des Wort über dies nahe und bräutliche Zusammensein, denn ein sonderbar feierliches Empfinden faltete stumme Flügel über sie alle, seit sie, ohnmächtig selber gegen das Schicksal, andern eine Handvoll Glück noch hatten zuteilen können. Und im geheimen war jeder dankbar für die wohltätige Ablenkung von dem eigenen unvermeidlichen Los. So lagen, im Dunkel verstreut, wach oder träumend, die Verurteilten auf ihren Strohsäcken bis zur Frühe, und selten nur durchwogte ein Seufzer den vom verlorenen Atem dicht erfüllten Raum.
Als dann am nächsten Morgen die Soldaten eintraten, um die vierundachtzig Verurteilten zur Richterstatt zu führen, fanden sie alle schon wach und völlig bereit. Nur im Nebenraum, wo die Vermählten weilten, blieb es still: selbst der harte Stoß der Kolben’hatte die Ermüdeten nicht geweckt. So eilte der Brautführer leise hinüber, damit nicht der Henker es sei, der die Glücklichen gewaltsam erwecke. Sie lagen locker umschlungen, ihre Hand wie vergessen unter seinem rücklings geneigten Nacken; selbst in der weichen Erstarrung des Schlafes glänzten ihre Gesichter so selig entspannt, daß es dem Mitfühlenden schwer ward, solchen Frieden zu stören. Aber er durfte nicht zögern und rührte mit drängender Mahnung erst ihn an, der taumelnd aufblickte, mit einem Riß aber die Lage besann und zärtlich die Gefährtin vom Lager aufhob. Sie blickte empor, kindhaft erschreckt, doch nur von dem allzu jähen Auftauchen in die eisige Wirklichkeit. Dann lächelte sie ihm einverständlich zu: »Ich bin bereit. «
Unwillkürlich machten alle, als die beiden Hand in Hand eintraten, ihnen Platz, und so ergab es sich ohne Absicht, daß die Neuvermählten den Todesgang der Verurteilten eröffneten. Obwohl den täglichen Anblick jener traurigen Trupps schon gewohnt, blickten diesmal die Leute noch staunend dem sonderbaren Zuge nach, denn von diesen beiden Menschen, die ihn eröffneten, dem jungen Offizier und der mit bräutlichem Kranze geschmückten Frau, strahlte eine so ungewohnte Heiterkeit und fast selige Sicherheit aus, daß selbst dumpfe Seelen hier ein hohes Geheimnis ehrfürchtig fühlten. Aber auch die anderen Verurteilten stapften nicht den sonst schlürfenden Trott der zum Tode Geführten, sondern jeder von ihnen starrte auf die beiden, denen dreimal so unvermutete Wunscherfüllung geworden war, brennenden Blicks und mit dem verzweifelt angekrallten Vertrauen,• noch einmal müsse, noch einmal werde an diesen beiden Glücklichen ein letztes Wunder sich ereignen und sie alle damit vom sicheren Tode erretten.
Aber das Leben liebt nur das Wunderbare und spart mit dem wirklichen Wunder: einzig das in Lyon damals Tagtägliche geschah. Der Zug wurde über die Brücke auf die sumpfigen Felder von Brotteaux geführt, dort erwarteten ihn zwölf Pelotons Infanterie, je drei Flintenläufe für den einzelnen Mann. Man stellte sie in Reih und Glied: Eine einzige Salve krachte alle nieder. Dann warfen die Soldaten die noch blutenden Leichen in die Rhöne, deren rasche Strömung Antlitz und Schicksal dieser Unbekannten gleichgültig in sich hinunternahm. Nur der hochzeitliche Kranz, der sich vom Haupte der Sinkenden leichter gelöst hatte, schwamm einige Zeit noch sinnlos und fremd auf den weiterwandernden Wellen. Schließlich entschwand auch er und mit ihm für lange Zeit das Gedächtnis jener von den Lippen des Todes gelösten und darum denkwürdigen Liebesnacht.
In the Snow and other stories (e-book)
[1] by Ray.
[2] Herostratus was a celebrated arsonist of antiquity who set fire to the temple of Artemis in Ephesus in the 4th-century B.C.
[3] “mitrailleur de Lyon” = the gunner of Lyon.
[4] refractory priest: a member of the clergy of the Catholic Church who refused to acknowledge the French government as supreme authority of the Church in France during the French Revolution.
[5] Ego auctoritate sanctae matris Ecclesiae qua fungor conjungo vos in matrimoniam in nomine Patris et Filii Spiritus sancti.: "I join you in marriage by the Holy Mother Church, in the name of the Holy Father and the Son.".